Arachnophobie ist die Angst vor Spinnentieren. Spinnen gehören im übrigen bei Phobikern zu den meist gefürchteten Tieren, wobei nicht eindeutig geklärt ist, warum gerade Spinnen so extreme Reaktionen bei manchen Menschen hervorrufen. Am häufigsten sind Phobien vor Tieren, die der menschlichen Silhouette am wenigsten ähnlich sind, und das ist bei Spinnentieren der Fall. Man vermutet auch, dass es nicht daran liegt, dass Phobiker Angst vor einem Spinnenbiss haben, sondern es liegt eher am Bewegungsmuster der Tiere.
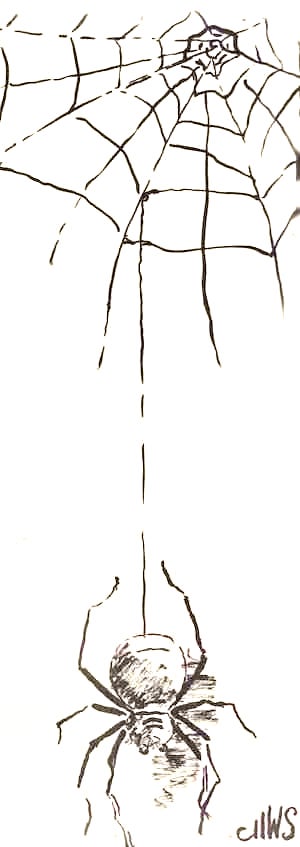 In einer Studie untersuchten Gerdes & Alpers (2013) jeweils zwanzig Menschen mit und ohne Spinnenphobie mittels der Methode der binokularen Rivalität, bei der über ein Stereoskop jeweils auf das linke und das rechte Auge zwei unterschiedliche Bilder projiziert werden. Im Experiment war es das Bild einer Spinne oder einer Blume gepaart mit dem neutralen Bild einer geometrischen Form. Diese Methode beruht darauf, dass es Menschen nicht möglich ist, dauerhaft zwei verschiedene Bilder gleichzeitig wahrzunehmen, sodass sie in einem Wettstreit stehen, wobei das Gehirn zu Gunsten eines Bildes entscheidet, ohne dass man darauf bewusst Einfluss nehmen kann. Menschen mit Angst nahmen das Bild der Spinne früher, länger und damit dominanter wahr als nicht phobische Probanden. Offensichtlich geht dieser Unterschied auf die emotionale Bedeutung der Spinnen für die Phobiker zurück, denn im Gehirn, wo entschieden wird, welches Bild Einzug in die bewusste Wahrnehmung erhält, spielen Emotionen wie Angst eine große Rolle, sodass das Spinnenbild sich bei Menschen mit einer Phobie früher und häufiger im Wahrnehmungswettstreit gegen das neutrale Bild durchsetzt.
In einer Studie untersuchten Gerdes & Alpers (2013) jeweils zwanzig Menschen mit und ohne Spinnenphobie mittels der Methode der binokularen Rivalität, bei der über ein Stereoskop jeweils auf das linke und das rechte Auge zwei unterschiedliche Bilder projiziert werden. Im Experiment war es das Bild einer Spinne oder einer Blume gepaart mit dem neutralen Bild einer geometrischen Form. Diese Methode beruht darauf, dass es Menschen nicht möglich ist, dauerhaft zwei verschiedene Bilder gleichzeitig wahrzunehmen, sodass sie in einem Wettstreit stehen, wobei das Gehirn zu Gunsten eines Bildes entscheidet, ohne dass man darauf bewusst Einfluss nehmen kann. Menschen mit Angst nahmen das Bild der Spinne früher, länger und damit dominanter wahr als nicht phobische Probanden. Offensichtlich geht dieser Unterschied auf die emotionale Bedeutung der Spinnen für die Phobiker zurück, denn im Gehirn, wo entschieden wird, welches Bild Einzug in die bewusste Wahrnehmung erhält, spielen Emotionen wie Angst eine große Rolle, sodass das Spinnenbild sich bei Menschen mit einer Phobie früher und häufiger im Wahrnehmungswettstreit gegen das neutrale Bild durchsetzt.
Arachnophobiker schätzen übrigens die Körpergröße von Spinnen falsch ein, was auf eine verzerrte Wahrnehmung hindeutet. In einem Versuch von Shiban et al. (2016) zeigte sich, dass die Arachnophobiker die Tiere deutlich größer einschätzen als eine Vergleichsgruppe. Nach einer Expositionstherapie verringerte sich die Verzerrung der Größeneinschätzung im Verlauf der Expositionsbehandlung deutlich, und nach der Therapie konnten keine Unterschiede zu der Vergleichsgruppe mehr nachgewiesen werden.
Rakison & Derringer (2008) zeigten fünf Monate alten Kleinkindern eine Reihe von schematischen Figuren, die einer Spinne mehr oder weniger ähnlich sahen, und maßen dabei die Fixierungsdauer. Auch in diesem Fall zeigte sich, dass das Spinnenbild die längste Aufmerksamkeitsdauer hatte. Man vermutet nicht zuletzt auch deshalb, dass die Spinnenphobie keine allein durch Erziehung erworbene Angst darstellt, sondern dass diese Art von Tieren in der menschlichen Wahrnehmung ein angeborenes Alarmsystem auslösen.
![]() Dass die Angst vor Spinnen und Schlangen anscheinend angeboren ist, wird durch eine Untersuchung von Hoehl et al. (2017) bestätigt, denn schon sechsmonatige Babys zeigen beim Anblick von solchen Bildern Stressreaktionen, wobei sich die Augen in einer typischen Stressreaktion verändern. Da Kinder in diesem Alter noch kaum Gelegenheiten zum Lernen hatten, geht man also von einem angeborenen Verhalten aus, d. h., die Angst vor Spinnen und Schlangen hat offenbar einen evolutionären Ursprung und erinnert an die Reaktion auf diese Tiere vor 40 bis 60 Millionen Jahren, denn die Vorfahren des Menschen koexistierten damals mit gefährlichen Reptilien und Spinnen, wodurch sich die Furcht über einen sehr langen Zeitraum im Gehirn festgesetzt haben könnte. Auf andere gefährliche Raubtiere stießen die Ahnen des Menschen hingegen deutlich seltener, weshalb sich die Angst vor solchen Tieren nicht als Phobie im Gehirn verankert hat.
Dass die Angst vor Spinnen und Schlangen anscheinend angeboren ist, wird durch eine Untersuchung von Hoehl et al. (2017) bestätigt, denn schon sechsmonatige Babys zeigen beim Anblick von solchen Bildern Stressreaktionen, wobei sich die Augen in einer typischen Stressreaktion verändern. Da Kinder in diesem Alter noch kaum Gelegenheiten zum Lernen hatten, geht man also von einem angeborenen Verhalten aus, d. h., die Angst vor Spinnen und Schlangen hat offenbar einen evolutionären Ursprung und erinnert an die Reaktion auf diese Tiere vor 40 bis 60 Millionen Jahren, denn die Vorfahren des Menschen koexistierten damals mit gefährlichen Reptilien und Spinnen, wodurch sich die Furcht über einen sehr langen Zeitraum im Gehirn festgesetzt haben könnte. Auf andere gefährliche Raubtiere stießen die Ahnen des Menschen hingegen deutlich seltener, weshalb sich die Angst vor solchen Tieren nicht als Phobie im Gehirn verankert hat.
![]() Ähnlich wie bei anderen Primaten sind im Gehirn von Menschen offenbar von Geburt an Mechanismen verankert, mit denen Objekte rasch als Spinne und Schlange identifiziert werden, was eine schnelle Reaktion ermöglicht. Man vermutet, dass diese angeborene Stressreaktion auch eine Rolle bei Entstehung entsprechender Phobien spielen könnte.
Ähnlich wie bei anderen Primaten sind im Gehirn von Menschen offenbar von Geburt an Mechanismen verankert, mit denen Objekte rasch als Spinne und Schlange identifiziert werden, was eine schnelle Reaktion ermöglicht. Man vermutet, dass diese angeborene Stressreaktion auch eine Rolle bei Entstehung entsprechender Phobien spielen könnte.
Expositionstherapie – real oder virtuell?
Bei einer Expositionstherapie werden Betroffene unter kontrollierten und möglichst entspannten Bedingungen wiederholt mit dem angstauslösenden Objekt konfrontiert. Ziel ist es, einen Lernprozess in Gang zu setzen, der den Betroffenen verdeutlicht, dass der Auslöser ihrer Angst objektiv betrachtet harmlos ist.
Generalisierung auch der Heilung von Spinnenangst?
In einer Studie von Kodzaga et al. (2023) zeigte sich, dass eine Expositionstherapie gegen eine spezifische Angst auch andere Ängste mildern kann. Die aktuelle Studie untersuchte, ob eine Generalisierung der Expositionsbehandlung für unbehandelte Stimuli erreicht werden kann, die keine Ähnlichkeit in der Wahrnehmung aufweisen und zu einer anderen Angstkategorie gehören. Eine analoge Stichprobe von fünfzig Teilnehmern mit Angst vor Spinnen (tierbezogene Ängste) und Höhenangst (umweltbezogene Ängste) wurde getestet, wobei die Teilnehmer nach dem Zufallsprinzip entweder einer Expositionsbehandlung (n = 24) oder einer Kontrollbedingung (n = 26) zugewiesen wurden. Die Expositionsbehandlung war so konzipiert, dass sie nur auf die Angst der Teilnehmer vor Spinnen abzielte, während ihre Höhenangst unbehandelt blieb. Die Ergebnisse zeigten, dass die Effekte der Expositionstherapie auch auf die Höhenangst übertragbar waren, was sich in einer Verringerung des Vermeidungsverhaltens und der selbstberichteten Akrophobiesymptome zeigte. Der signifikante Effekt zeigte sich sowohl in den subjektiven als auch in den Verhaltensmaßen, den die Höhenangst nahm durch die Exposition mit Spinnen im Durchschnitt um 15 Prozent ab. Die Entdeckung, dass eine Exposition gegen Spinnenangst auch Höhenangst reduziert, eröffnet neue Perspektiven für die effiziente Behandlung von Ängsten, denn das könnte bedeuten, dass man die bisherigen Therapieansätze überdenken und möglicherweise universellere Methoden entwickeln könnte. Wie der Übertragungseffekt von der einen Angst zur anderen zustande kommt, ist bislang unklar, denn sssoziative Lernprozesse können den Effekt nicht gänzlich erklären. Man vermutet, dass der Generalisierungseffekt durch eine Zunahme der Selbstwirksamkeit infolge der Expositionstherapie entstanden sein könnte. und möglicherweise gibt es aber auch einen gemeinsamen Nenner zwischen Spinnen- und Höhenangst, der nicht offensichtlich ist. Die vorliegende Studie widerlegt zumindest die Annahme, dass die Generalisierung von Expositionseffekten auf unbehandelte Ängste auf Wahrnehmungsähnlichkeit beruht.
Smartphone-App Phobys
Schweizer Wissenschaftler der Universität Basel (Zimmer et al., 2021) haben die Smartphone-App Phobys entwickelt, die Betroffenen spielerisch Angst vor den Krabbeltieren nehmen soll, wobei sich die Probanden und Probandinnen nach zweiwöchigem Einsatz mit sechs halbstündige Trainingseinheiten Menschen mit Spinnenangst einer echten Spinne im Glaskasten besser nähern als Betroffene, die die App nicht genutzt hatten. Die App zeigt virtuelle Spinnen, die erst aus der Ferne und dann in der Nähe betrachtet werden können und sich schließlich bewegen. Wenn man die Handykamera auf die eigene Hand richtet, lässt sich mit der App eine sehr echt aussehende digitale Spinne auf den Handrücken setzen, denn für Menschen, die Angst vor Spinnen haben, ist es leichter, sich einer virtuellen Spinne auszusetzen als einer echten. Die App ist wie ein Handyspiel aufgebaut, d. h., über mehrere Stufen werden die Übungen immer schwieriger.
Link zur Website: https://www.phobys.com/ (21-10-28)
Betablocker Propranolol als Unterstützung bei der Behandlung von Phobien
Soeter & Kindt (2015) schlagen bei Phobien eine Unterbrechung des Prozesses der Gedächtnis-Rekonsolidierung vor, indem sie spinnenängstlichen Probanden doppelblind und placebokontrolliert eine Einzeldosis von 40 mg des noradrenergen Betablockers Propranolol nach einer kurzen 2-minütigen Exposition gegenüber einer Tarantel verabreichten, um zu testen, ob eine Gedächtnisreaktivierung notwendig ist, um einen angstreduzierenden Effekt zu beobachten. Die Unterbrechung der Rekonsolidierung des Furchtgedächtnisses wandelte dabei Vermeidungsverhalten sogar in Annäherungsverhalten um, ein Effekt, der mindestens ein Jahr nach der Behandlung anhielt. Propranolol ist ein Betablocker, der für gewöhnlich gegen Bluthochdruck eingesetzt wird. Propranolol hilft den Menschen offenbar dabei, Erlebnisse wie jenes mit einer Vogelspinne als weniger traumatisch zu empfinden, sie wirkt aber auch auf das selektive Gedächtnis und hilft von Arachnophobie Betroffenen und die damit verbundenen angstbedingten Traumata zu vergessen.
Training gegen Spinnen- und Hundeangst
Im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts der Ruhr-Universität Bochum sucht die Fakultät für Psychologie (Klinische Psychologie und Psychotherapie) Kinder, die unter Angst vor Spinnen oder Hunden leiden und möchten ihnen die Möglichkeit bieten, die spezifische Angst im Rahmen eines eintägigen Trainings zu bewältigen. Dabei wird es drei verschiedenen Trainingsbedingungen geben. Entweder bietet man dem Kind allein ein spezifisches Training gegen Spinnen-/Hundeangst an oder eine ähnliche Behandlung, an welcher man mit seinem Kind gemeinsam teilnehmen kann. Die dritte Variante sieht ein Eltern-Training vor, bei welchem diese lernen, ihrem Kind dabei zu helfen, die Angst zu bewältigen. Die Trainings finden am 13. und 14. Januar 2023 statt.
Ziel ist es, den Eltern und dem Kind wirksame Strategien gegen Spinnen-/Hundeangst zu vermitteln und diese praktisch anzuwenden. Das Training orientiert sich dabei an den aktuellen Forschungsstandards der kognitiven Verhaltenstherapie. Das Programm ist kostenfrei und sämtliche Daten, die im Rahmen des Projektes erhoben werden, werden anonymisiert und streng vertraulich behandelt. Die Trainings werden voraussichtlich am 13. & 14.01.2023 stattfinden. Für eine Anmeldung bitte eine Mail an fbz-hilfe-bei-hunde-und-spinnenangst@rub.de.
Literatur
Gerdes, Antje B. M. & Alpers, Georg W. (2013). You See What You Fear: Spiders Gain Preferential Access to Conscious Perception in Spider-Phobic Patients. Journal of Experimental Psychopathology, 4, 1-15.
Rakison, D. H. & Derringer, J. (2008). Do infants possess an evolved spider-detection mechanism? Cognition, 107, 381–393.
Hoehl, S., Hellmer, K., Johansson, M. & Gredebäck, G. (2017). Itsy Bitsy Spider: Infants React with Increased Arousal to Spiders and Snakes. Frontiers in Psychology, 8, doi: 10.3389/fpsyg.2017.01710.
Kodzaga, Iris, Dere, Ekrem & Zlomuzica, Armin (2023). Generalization of beneficial exposure effects to untreated stimuli from another fear category. Translational Psychiatry, 13, doi:10.1038/s41398-023-02698-7.
Leehr, Elisabeth J., Roesmann, Kati, Böhnlein, Joscha, Dannlowski, Udo, Gathmann, Bettina, Herrmann, Martin J., Junghöfer, Markus, Schwarzmeier, Hanna, Seeger, Fabian R., Siminski, Niklas, Straube, Thomas, Lueken, Ulrike & Hilbert, Kevin (2021). Clinical predictors of treatment response to exposure therapy in virtuo in spider phobia: A machine learning and external cross-validation approach. Journal of Anxiety Disorders, 83, doi:10.1016/j.janxdis.2021.102448.
Soeter, Marieke & Kindt, Merel (2015). An Abrupt Transformation of Phobic Behavior After a Post-Retrieval Amnesic Agent. Biological Psychiatry, 78, 880-886.
Stangl, W. (2021, 18. November). Was kann man gegen die Angst vor Spinnen unternehmen? Psychologie-News.
https:// psychologie-news.stangl.eu/4801/was-kann-man-gegen-die-angst-vor-spinnen-unternehmen.
Youssef Shiban, Martina B. Fruth, Paul Pauli, Max Kinateder, Jonas Reichenberger & Andreas Mühlberger (2016). Treatment effect on biases in size estimation in spider phobia. Biological Psychology, doi:10.1016/j.biopsycho.2016.03.005.
Zimmer, Anja, Wang, Nan, Ibach, Merle K., Fehlmann, Bernhard, Schicktanz, Nathalie S., Bentz, Dorothée, Michael, Tanja, Papassotiropoulos, Andreas & de Quervain, Dominique J.F. (2021). Effectiveness of a smartphone-based, augmented reality exposure app to reduce fear of spiders in real-life: A randomized controlled trial. Journal of Anxiety Disorders, 82, doi:10.1016/j.janxdis.2021.102442.
Bildquelle
https://kunst.stangl.eu/gestern-heute-morgen-mit-spinne/ (21-09-09)
In Deutschland leiden viele Menschen unter einer starken Angst vor Spinnen (Arachnophobie), obwohl die meisten Arten hierzulande ungefährlich sind. Diese Angst kann das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Eine neue Studie am Universitätsklinikum Würzburg untersucht, ob eine gezielte Magnetstimulation des Gehirns die Phobie lindern könnte. Dabei wird die Methode der transkraniellen Magnetstimulation (TMS) eingesetzt, die auf das Angstgedächtnis abzielt. Die Studie mit dem Namen „SpiderMEM“ sucht derzeit Teilnehmer mit Spinnenphobie, um die Wirksamkeit dieser Behandlung zu testen. Bei erfolgreicher Anwendung könnte TMS die gängige Expositionstherapie ersetzen, bei der Betroffene schrittweise mit Spinnen konfrontiert werden, um ihre Angst zu überwinden. Die TMS-Methode könnte auch bei anderen Erkrankungen wie Depressionen oder Tinnitus eingesetzt werden. Bisher sind die Nebenwirkungen gering, da die Magnetstimulation nicht invasiv ist. Um die Langzeiteffekte zu überprüfen, müssen die Teilnehmer mehrere Sitzungen absolvieren, die insgesamt rund fünf Stunden in Anspruch nehmen. Arachnophobie gehört zu den häufigsten Angststörungen, die vor allem Frauen betreffen.