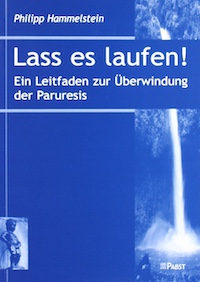 Als Paruresis bezeichnet die klinische Psychologie die vorwiegend bei Männern auftretende Hemmung, öffentliche Toiletten zu benutzen. In der Psychologie ist die psychisch bedingte Entleerungsstörung eine Subform der sozialen Phobie, wobei die Bezeichnung Paruresis G.W. Williams und E.T. Degenhardt erstmals 1954 eingeführt haben. Für die meisten Betroffenen kann Paruresis zum Gesundheitsrisiko werden, denn um Toilettengänge zu vermeiden, trinken sie untertags extrem wenig und bringen damit ihre Nieren in Gefahr.
Als Paruresis bezeichnet die klinische Psychologie die vorwiegend bei Männern auftretende Hemmung, öffentliche Toiletten zu benutzen. In der Psychologie ist die psychisch bedingte Entleerungsstörung eine Subform der sozialen Phobie, wobei die Bezeichnung Paruresis G.W. Williams und E.T. Degenhardt erstmals 1954 eingeführt haben. Für die meisten Betroffenen kann Paruresis zum Gesundheitsrisiko werden, denn um Toilettengänge zu vermeiden, trinken sie untertags extrem wenig und bringen damit ihre Nieren in Gefahr.
In der englischen Fachliteratur wird von einem „bashful bladder syndrome“ gesprochen, da die meisten Betroffenen zunächst an eine körperliche Ursache denken wie eine Entzündung oder eine vergrößerte Prostata. Kaum wird an eine Angststörung oder psychische Ursache gedacht. Der psychische Stress wird durch die Anwesenheit einer anderen Person beim Wasserlassen ausgelöst, der den Ringmuskel zur Kontrolle des Harndranges zuschnürt.
Hinter dieser Phobie können verschiedene Ursachen stehen wie etwa eine Zwangsstörung, sich schmutzig zu machen oder Krankheiten einzufangen. Bei manchen Betroffenen ist es schlicht die Unfähigkeit, in Gegenwart anderer Menschen auch nur einen Tropfen Urin hervorzubringen, oder das peinliche Gefühl, Geräusche zu erzeugen, die andere hören könnten.
Die Betroffenen ertragen es oft nicht, ein WC aufzusuchen, das mehrere Kabinen hat, denn sie fühlen sich dort beobachtet. Manchen macht es auch Schwierigkeiten, in der Toilette einer Arztpraxis eine Urinprobe abzugeben, sodass sie notwendige medizinische Behandlungen verweigern, um einer solchen Situation zu entgehen. Diese Angst kann so groß werden, dass Lokale, Kinos und Feste gemieden werden, weil man dort irgendwann das WC aufsuchen muß. Die Folge ist oft ein sozialer Rückzug, der zu Depressionen führen kann. Ursache kann ein Gefühl der Beengung auf öffentlichen WC-Anlagen oder Angst vor Infektionen sein.
Es gibt einen Verein Austrian Paruresis Association (ATPA) mit einer Selbsthilfegruppe, bei der man sich ganz anonym austauschen und auch melden kann, wenn man Hilfe in Anspruch nehmen möchte. In Workshops geht es vor allem darum, sich auszutauschen, festzustellen, dass man nicht allein ist. Bei dem Workshop können sich Betroffene also vor allem austauschen, es werden verschiedene Entspannungsübungen gezeigt, und dann gibt es noch Pee-Buddys. Dabei gehen immer zwei Teilnehmer oder Teilnehmerinnen zusammen in verschiedene Lokale oder öffentliche Toiletten. Beide versuchen sich dann ihren Ängsten zu stellen und probieren auf einer öffentlichen Toilette zu urinieren. Da der Pee-Buddy die Ängste des anderen sehr gut kennt und sich beide in der gleichen Situation befinden, fällt es leichter, sich seinen Ängsten zu stellen. Link: paruresis.at
 Alle, die glauben, sie könnten sich auf fremden Toiletten mit Krankheiten anstecken, dürfen beruhigt sein, denn nach wissenschaftlichen Untersuchungen gehen von Toiletten wenig Gefahren aus. Eine Infektionsgefahr besteht nur dann, wenn sich Menschen nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen, sodass Keime aus dem Stuhlgang auch ins Essen gelangen und Krankheiten auslösen. Übrigens ist jede Computertastatur mit mehr gefährlichen Bakterien belastet als ein WC-Brille.
Alle, die glauben, sie könnten sich auf fremden Toiletten mit Krankheiten anstecken, dürfen beruhigt sein, denn nach wissenschaftlichen Untersuchungen gehen von Toiletten wenig Gefahren aus. Eine Infektionsgefahr besteht nur dann, wenn sich Menschen nach dem Toilettengang nicht die Hände waschen, sodass Keime aus dem Stuhlgang auch ins Essen gelangen und Krankheiten auslösen. Übrigens ist jede Computertastatur mit mehr gefährlichen Bakterien belastet als ein WC-Brille.
Als Therapie biete sich u. a. die systematische Desensibilisierung an, eine Methode der Verhaltenstherapie. Manche Psychologen vermuten, dass auch der allgemeine Umgang mit menschlichen Ausscheidungen und eine daraus resultierende Verklemmung die Ursache sein kann, was man an den verklausulierten Umschreibungen der entsprechenden Einrichtungen und Tätigkeiten erkennen kann. Sigmund Freud vertrat die Ansicht, dass die Angewohnheit von Männern, sich beim Urinieren gegenseitig zu übertreffen, eine bis in früheste Vorzeiten zurückreichende Austragungsform männlicher Rivalitäten ist. Auslöser sind oft Schlüsselerlebnisse in der Pubertät, woraus die Angst, dass eine solche Situtation noch einmal auftreten kann, beim nächsten Toilettengang eine Stressreaktion auslöst, wodurch sich die Ringmuskeln kontrahieren, angespannt bleiben und die Harnröhre verschließen. Der Körper reagiert bei Angststörungen wie auch in bedrohlichen Situationen oft mit Kampf-Flucht-Reaktionen, die sich zum Teil evolutionär erklären lassen, denn drohte Gefahr, war es für die Vorfahren vermutlich nicht sinnvoll, stehen zu bleiben und zu urinieren.
Im englische Sprachraum ist dieses Phänomen als „Shy Bladder Syndrome“ bekannt. Die National Phobic Society betrachtet die Toiletten-Phobie als eine eigenständige Angststörung und hat eine Kampagne gestartet, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Siehe dazu Angst, Panikattacken, Angst vor der Angst.
Neuere Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn mit der Beckenbodenmuskulatur eng vernetzt ist, denn für das Wasserlassen muss bekantlich die Beckenbodenmuskulatur entspannt werden. Das entdeckte man durch einen einfachen Versuch, den man selber leicht nachvollziehen kann: dafür muss man nur die Zehen intensiv bewegen und dabei spüren, bis wohin man die Anspannung wahrnehmen kann, wobei sich zeigt, dass man das Zusammenziehen zwar nicht bis zur Beckenbodenmuskulatur, wohl aber bis zum Gesäß spürt. Bewegt man hingegen die Finger, ist kein Zusammenhang spürbar. Offensichtlich wird die Anspannung der Gefäßmuskeln auch an die Beckenbodenmuskulatur weitergeben. Da in der Regel solche Verbindungen bidirektional wirken, könnte auch die Paruresis auf diesen engen Zusammenhang zurückzuführen sein. Des Weiteren findet sich bei vielen Menschen das Phänomen, das sie bereits bei dem Gedanken, Wasser lassen zu müssen, die Beckenmuskulatur entspannen, sodass sie es nicht bis zum WC schaffen. Viele Menschen werden bekanntlich auch durch das Plätschern vom Wasser oder das Rinnen von Wasser zum Wasserlassen angeregt.
Literatur
Hammelstein, Ph. (2005). Lass es laufen! Ein Leitfaden zur Überwindung der Paruresis. Lengerich: Pabst.
Rein körperlich gesehen verspannt sich die Blase so sehr, dass die Personen nicht mehr loslassen können. „Das Ganze passiert mehr oder weniger immer dann, wenn man sozialem Druck ausgesetzt ist,“ erklärt Johannes Lanzinger, Klinischer Psychologe und Gesundheitspsychologe bei Phobius, einem Zentrum zur Behandlung von Panik, Angst und Phobien, in Wien. Vor allem Männer zwischen 18 und Mitte 20 kennen dieses Problem. „In dieser Zeit geht es darum, seine Männlichkeit zu finden und sich zu behaupten. Vielen passiert es dann, dass sie beim Pissoir stehen und es kommt nichts. Manchmal hört man dann auch dumme Sprüche von den Freunden,“ sagt Lanzinger. Bei den meisten legt sich dieses Problem schnell wieder. Bei manchen aber bleibt es und wird sogar immer schlimmer, bis es sich schließlich zu einer Angststörung manifestiert. Es gibt auch Frauen, die unter einer schüchternen Blase leiden, aber beim Großteil handelt es sich um Männer. „Gerade das Pissoir trägt dazu bei, dass es zu einer Paruresis kommen kann. Oftmals steht man sich Gegenüber beim Pinkeln und muss sich manchmal auch komische Kommentare von anderen Männern anhören. Wenn es dann nicht klappt, wird schnell die eigene Männlichkeit in Frage gestellt“, sagt der Psychologe.
Wie bei den meisten sozialen Phobien, spielt auch bei der schüchternen Blase eine starke Selbstabwertung eine große Rolle. „Die Personen fühlen sich nicht normal. Sie haben immer die Angst, dass die Menschen um sie herum etwas ahnen könnten. Oftmals suchen sie statt dem Pissoir die Kabine auf und versuchen auch dort möglichst leise zu urinieren, nur damit niemand sie bemerkt“, erklärt der Psychologe. „Bei einigen ist es aber auch so schlimm, dass sie sich immer weiter aus dem sozialen Leben zurückziehen und Bars oder Restaurants meiden.“
Quelle: https://www.derstandard.at/story/3000000173444/wenn-pinkeln-zum-problem-wird (23-06-09)