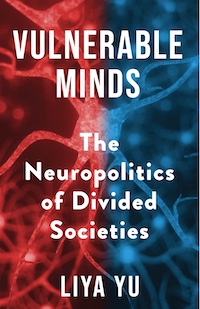 Wenn man heute den Begriff Neuropolitik hört, begegnet man einem Begriff, der in vielerlei Hinsicht symptomatisch für unsere Zeit ist – einer Ära, in der das Präfix „Neuro-“ zum Modewort avanciert und gern zur Aufladung unterschiedlichster Diskurse eingesetzt wird. Der Begriff suggeriert eine neurowissenschaftliche, tiefenverstehende Einsicht in politische Prozesse – und genau diese Suggestion birgt ein Problem. Zwar beschreibt Neuropolitik ein interdisziplinäres Feld, das Neurowissenschaften, Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften verknüpft – etwa um mittels EEG oder fMRT emotionale Reaktionen auf politische Botschaften zu erfassen. Doch liegt die Gefahr darin, dass hier ein Neologismus entsteht, der mit dem Glanz der Begriffe „Gehirn“ und „Wissenschaft“ spielerisch operiert – ohne dass daraus zwingend tieferes Verständnis oder reale politische Anwendung folgt. Die Politikwissenschaftlerin Liya Yu hat den Begriff als vielversprechende Basis für einen neuen Gesellschaftsvertrag ins Spiel gebracht. In ihrem Buch „Vulnerable Minds – The Neuropolitics of Divided Societies“ führt sie aus, dass neuropolitische Forschung aufzeigt, wie politische Phänomene auf Gehirnebene erklärt werden können – Phänomene, die Umfragen allein nicht erfassen, etwa angstinduzierte Reaktionen auf Menschen anderer Hautfarbe. Solche Einsichten mögen subtilen, oft unbewussten Mechanismen auf die Spur kommen. Doch ist es legitim, daraus politischen Aufbruch zu stricken? Yu argumentiert, man könne Polarisierung nicht durch Ideologien oder moralische Appelle überwinden, sondern müsse zuerst die Hirnmechanismen von In- und Out-Groups verstehen. Der Ansatz ist ambitioniert – aber zugleich anfällig für Verkürzungen, in denen komplexe psychologische Prozesse auf vereinfachende neurobiologische Erklärungen heruntergedampft werden.
Wenn man heute den Begriff Neuropolitik hört, begegnet man einem Begriff, der in vielerlei Hinsicht symptomatisch für unsere Zeit ist – einer Ära, in der das Präfix „Neuro-“ zum Modewort avanciert und gern zur Aufladung unterschiedlichster Diskurse eingesetzt wird. Der Begriff suggeriert eine neurowissenschaftliche, tiefenverstehende Einsicht in politische Prozesse – und genau diese Suggestion birgt ein Problem. Zwar beschreibt Neuropolitik ein interdisziplinäres Feld, das Neurowissenschaften, Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften verknüpft – etwa um mittels EEG oder fMRT emotionale Reaktionen auf politische Botschaften zu erfassen. Doch liegt die Gefahr darin, dass hier ein Neologismus entsteht, der mit dem Glanz der Begriffe „Gehirn“ und „Wissenschaft“ spielerisch operiert – ohne dass daraus zwingend tieferes Verständnis oder reale politische Anwendung folgt. Die Politikwissenschaftlerin Liya Yu hat den Begriff als vielversprechende Basis für einen neuen Gesellschaftsvertrag ins Spiel gebracht. In ihrem Buch „Vulnerable Minds – The Neuropolitics of Divided Societies“ führt sie aus, dass neuropolitische Forschung aufzeigt, wie politische Phänomene auf Gehirnebene erklärt werden können – Phänomene, die Umfragen allein nicht erfassen, etwa angstinduzierte Reaktionen auf Menschen anderer Hautfarbe. Solche Einsichten mögen subtilen, oft unbewussten Mechanismen auf die Spur kommen. Doch ist es legitim, daraus politischen Aufbruch zu stricken? Yu argumentiert, man könne Polarisierung nicht durch Ideologien oder moralische Appelle überwinden, sondern müsse zuerst die Hirnmechanismen von In- und Out-Groups verstehen. Der Ansatz ist ambitioniert – aber zugleich anfällig für Verkürzungen, in denen komplexe psychologische Prozesse auf vereinfachende neurobiologische Erklärungen heruntergedampft werden.
Neuropolitik wirbt auch mit einem Zugang „jenseits der Ideologie“, doch gerade in emotional aufgeladenen politischen Landschaften kann ein neurozentrierter Blick leicht zum Ersatz für gesellschaftliche, ökonomische und historische Dynamiken werden. Der Begriff bleibt vage: Wird er zur analytischen Bereicherung genutzt oder bloß ornamentaler Label-Luxus, der pseudowissenschaftliche Aura verleihen soll? Kritiker warnen davor, dass neurowissenschaftliche Methoden überzogen interpretiert werden – so etwa beim „Neuroskeptizismus“, der betont, dass fMRT-Bilder keine direkten Hirn-„Landkarten“, sondern statistisch aufbereitete Daten sind.
Zudem erinnert die Sprachgeschichte an ähnliche Phänomene: „Neurozentrismus“ etwa bezeichnet die Tendenz, das menschliche Bewusstsein einzig über das Gehirn zu erklären – und wichtige kulturelle, soziale oder philosophische Dimensionen auszublenden. Auch Neuropädagogik ist vielfach Kritiken ausgesetzt: als Sammelbegriff ohne klaren, wissenschaftlich fundierten Kern, der „Neuro-“ einfach suggeriert, ohne Substanz zu liefern. In diesem Sinne ist Neuropolitik gefährdet, ähnlich zu fungieren: als attraktives Schlagwort, das auf dem Neuro-Buzz mitreitet, aber in seinen Ansprüchen latent dünn bleibt.
Dennoch gibt es auch ernsthafte Versuche, dem Begriff mehr Substanz zu geben: Studien etwa untersuchten den Zusammenhang zwischen Gehirnstruktur und politischer Orientierung – etwa das Ergebnis, dass konservativere Menschen größere Mandelkerne und progressivere Personen eher einen stärker ausgeprägten anterioren cingulären Cortex aufweisen. Forschende haben zudem Konzepte wie „rigidity“, „flexibility“ und „plasticity“ des Gehirns in politische Entscheidungsprozesse eingeführt. In Indonesien gibt es sogar neuropolitische Lehrbücher, die versuchen, diese Interdisziplin zu akademisieren. Doch die Verbreitung solcher Arbeiten ist oft regional begrenzt und vermag den Überschwang um das Schlagwort nur selten zu strukturieren.
Man muss also fragen: Ist Neuropolitik ein innovatives Forschungsfeld oder vor allem ein rhetorischer Zug? Die Vorstellung, politische Polarisierung durch das Verstehen neurologischer Mechanismen zu überwinden, klingt attraktiv – doch sie läuft Gefahr, andere Ebenen wie sozioökonomische Faktoren, Machtverhältnisse und ideologische Prozesse zu marginalisieren. Die Gefahr besteht darin, dass Neuropolitik als wissenschaftliche Begleiterscheinung von Neuromarketing fungieren könnte, in dem politische Ansprache manipulativ neuro-orientiert gestaltet wird.
Ein kritischer Blick bleibt daher notwendig: Der Begriff mag neue Blickwinkel eröffnen, doch wir müssen wachsam gegenüber neurozentristischen Verlockungen bleiben und geistige Bescheidenheit üben. Neuropolitik als Schlagwort ist reizvoll – aber nur der Beginn einer ernsthaften Frage, deren Tragweite weit über Gehirnregionen hinausgeht.
Literatur
Deutsche Apotheker Zeitung. (2024, 15. Oktober). *Gibt es Neuropolitik?* Newsletter der Deutschen Apotheker Zeitung. Abgerufen am 9. September 2025.
Gedankenwelt. (o. J.). *Was ist Neuropolitik?* Abgerufen am 9. September 2025.
Hasan, R. (2024). Neuropolitik und soziale Entscheidungsfindung. Jakarta: Lemhannas Institute.
Suarapembaruan. (2024). Diskussion: Neuropolitik und Social Decision Making – auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen? Suara Pembaruan News. Abgerufen am 9. September 2025.
Wikipedia. (o. J.). Neurozentrismus. In Wikipedia. Abgerufen am 9. September 2025.
Yu, L. (2022). Vulnerable minds: The neuropolitics of divided societies. Cambridge: Cambridge University Press.