Rigidität bezeichnet in der Psychologie eine starre und wenig flexible Art des Denkens, Fühlens und Handelns, die mit einer eingeschränkten Fähigkeit zur Anpassung an neue Situationen oder Informationen einhergeht. Der Begriff hat seinen Ursprung in der klinischen Psychologie und der Persönlichkeitsforschung, wird heute jedoch in vielen psychologischen Teildisziplinen verwendet. Unter kognitiver Rigidität versteht man die Tendenz, Denkmuster nur schwer zu verändern, wodurch Betroffene dazu neigen, in einmal etablierten Kategorien zu verharren, selbst wenn diese nicht mehr angemessen sind. Ein klassisches Beispiel für die Messung dieses Konstrukts ist der Wisconsin Card Sorting Test, bei dem die Schwierigkeit, die Sortierregel nach einem Regelwechsel zu modifizieren, als Indikator für kognitive Flexibilität oder deren Fehlen gilt (Grant & Berg, 1948).
Rigidität kann auf unterschiedlichen Ebenen auftreten: Kognitiv äußert sie sich in Schwarz-Weiß-Denken, mangelnder Ambiguitätstoleranz und Schwierigkeiten beim Perspektivenwechsel; affektiv zeigt sie sich in einer eingeschränkten emotionalen Anpassungsfähigkeit; behaviorale Rigidität wiederum betrifft stereotype Handlungsweisen, die auch bei veränderten Kontexten unverändert fortgeführt werden.
In der klinischen Psychologie ist Rigidität unter anderem relevant für das Verständnis von Zwangsstörungen, Autismus-Spektrum-Störungen und Depressionen, bei denen häufig ein eingeschränktes Repertoire an flexiblen Strategien beobachtet wird (American Psychiatric Association, 2013). Darüber hinaus hat die Forschung der letzten Jahre den Begriff verstärkt in gesellschaftlich-politische Zusammenhänge gestellt.
Leor Zmigrod (2020, 2022) konnte zeigen, dass kognitive Rigidität eng mit ideologischem Dogmatismus, Intoleranz und Extremismus verbunden ist. Nach ihrer Auffassung neigen Personen mit hoher Rigidität stärker zu festen Überzeugungssystemen, weil diese psychologische Sicherheit und Klarheit in komplexen sozialen Umwelten bieten. Somit wird Rigidität nicht mehr nur als klinisches Symptom, sondern auch als grundlegende kognitive Disposition verstanden, die individuelle Unterschiede im Umgang mit Unsicherheit und Veränderung erklärt. Neuropsychologische Befunde deuten darauf hin, dass Strukturen wie der präfrontale Cortex und der anteriore cinguläre Cortex an der Regulation kognitiver Flexibilität beteiligt sind und dass Unterschiede in der Funktionsweise dieser Areale mit rigiden Denkstilen korrelieren (Dajani & Uddin, 2015). Trotz zahlreicher empirischer Arbeiten bleibt jedoch umstritten, inwieweit Rigidität ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal oder eine situationsabhängige Reaktionsweise darstellt. Während einige Forscher sie als überdauernde Dimension kognitiver Stile betrachten, argumentieren andere, dass sie stark von Kontextfaktoren wie Stress, Zeitdruck oder sozialen Normen beeinflusst ist. Rigidität gilt daher als multidimensionales Konzept, das sowohl klinische, entwicklungspsychologische als auch sozialpsychologische Relevanz besitzt und einen wichtigen Schlüssel zum Verständnis individueller und kollektiver Denk- und Verhaltensmuster darstellt.
Rigidität als Grundmuster menschlichen Denkens?
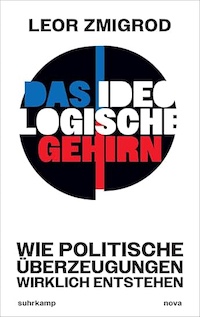 Die Neuropsychologin Leor Zmigrod versteht unter Rigidität eine grundlegende kognitive Disposition, die sich in der Unfähigkeit zeigt, flexibel zwischen unterschiedlichen Denkweisen zu wechseln und sich an Veränderungen anzupassen. Sie äußert sich in Schwarz-Weiß-Denken, im Festhalten an starren Mustern und in einer geringen Toleranz für Mehrdeutigkeit. Diese kognitive Rigidität prägt nicht nur das alltägliche Problemlösen, sondern auch die ideologische Orientierung: Menschen, die unflexibel denken, neigen stärker zu dogmatischen Überzeugungen, Intoleranz und extremistischen Haltungen, weil starre Ideologien ihnen Klarheit und Sicherheit bieten. Zmigrod versucht, diesen Zusammenhang empirisch zu fassen, etwa durch neuropsychologische Tests wie den Wisconsin Card Sorting Test, der misst, wie schnell Personen ihre Strategien an veränderte Regeln anpassen können. Ihre Forschung verlagert den Blick dabei von äußeren Einflüssen wie Propaganda hin zu inneren Dispositionen und legt nahe, dass die neurologische Veranlagung zur Flexibilität oder Rigidität die Stärke ideologischer Bindungen beeinflusst.
Die Neuropsychologin Leor Zmigrod versteht unter Rigidität eine grundlegende kognitive Disposition, die sich in der Unfähigkeit zeigt, flexibel zwischen unterschiedlichen Denkweisen zu wechseln und sich an Veränderungen anzupassen. Sie äußert sich in Schwarz-Weiß-Denken, im Festhalten an starren Mustern und in einer geringen Toleranz für Mehrdeutigkeit. Diese kognitive Rigidität prägt nicht nur das alltägliche Problemlösen, sondern auch die ideologische Orientierung: Menschen, die unflexibel denken, neigen stärker zu dogmatischen Überzeugungen, Intoleranz und extremistischen Haltungen, weil starre Ideologien ihnen Klarheit und Sicherheit bieten. Zmigrod versucht, diesen Zusammenhang empirisch zu fassen, etwa durch neuropsychologische Tests wie den Wisconsin Card Sorting Test, der misst, wie schnell Personen ihre Strategien an veränderte Regeln anpassen können. Ihre Forschung verlagert den Blick dabei von äußeren Einflüssen wie Propaganda hin zu inneren Dispositionen und legt nahe, dass die neurologische Veranlagung zur Flexibilität oder Rigidität die Stärke ideologischer Bindungen beeinflusst.
Gleichzeitig wird Rigidität bei Zmigrod auch als ein spezifischer ideologischer Denkstil beschrieben, der drei Hauptmerkmale aufweist: das starre Festhalten an einer Doktrin, die Resistenz gegenüber neuen Informationen und den Ingroup-Outgroup-Bias, also die Bevorzugung der eigenen Sichtweise gegenüber anderen. Ihre Hypothese lautet, dass gedankliche Rigidität auf neuronaler Rigidität beruht. Damit verschiebt sie den Fokus von geisteswissenschaftlichen Deutungen hin zu neurowissenschaftlichen Erklärungen und stellt die These auf, dass ideologische Überzeugungen aus biologischen Grundlagen hervorgehen. Kritisch wird dabei jedoch angemerkt, dass dieser Ansatz einen „weichen Reduktionismus“ darstellt: Zwar lassen sich neuronale Aktivitäten mit Denkstilen korrelieren, doch das erkenntnistheoretische Problem des Verhältnisses von Geist und Gehirn bleibt ungelöst. Hinzu kommt die Gefahr, dass Zmigrods Ansatz selbst ideologisch wird, wenn sie die Vorstellung eines „anti-ideologischen Gehirns“ ins Spiel bringt, also eines Bewusstseins, das frei von Ideologien sein soll. Während ihre Forschung auf der einen Seite einen wertvollen Beitrag zur Erklärung von Ideologieanfälligkeit leistet, indem sie neurologische Dispositionen berücksichtigt, macht die Kritik deutlich, dass die Gefahr besteht, komplexe soziale und kulturelle Phänomene auf neuronale Prozesse zu verkürzen. Rigidität ist bei Zmigrod somit sowohl ein neurokognitives als auch ein ideologisches Phänomen, das praktische Relevanz für die Analyse und mögliche Prävention von Extremismus besitzt, zugleich aber auf einer theoretischen Ebene methodische und erkenntnistheoretische Fragen aufwirft.
Literatur
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Dajani, D. R., & Uddin, L. Q. (2015). Demystifying cognitive flexibility: Implications for clinical and developmental neuroscience. Trends in Neurosciences, 38(9), 571–578.
Grant, D. A., & Berg, E. A. (1948). A behavioral analysis of degree of reinforcement and ease of shifting to new responses in a Weigl-type card-sorting problem. Journal of Experimental Psychology, 38(4), 404–411.
Zmigrod, L. (2020). Cognitive underpinnings of ideological thinking. Trends in Cognitive Sciences, 24(8), 632–644.
Zmigrod, L. (2022). The ideological brain: How we come to believe. London: Penguin.