 Jean-Jacques Rousseau führte den Begriff der Perfektibilität in seinem Werk „Diskurs über die Ungleichheit“ (1755) ein. Unter Perfektibilität verstand Rousseau die einzigartige Fähigkeit des Menschen, sich selbst und seine Umgebung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Perfektibilität bezeichnet dabe ein anthropologisches Konzept sowie ein Ideal der Aufklärung, wobei dieser Begriff aus dem Französischen ins Deutsche übertragen und sowohl mit „Vervollkommnungsfähigkeit“ als auch „Vervollkommnung“ wiedergegeben wird.
Jean-Jacques Rousseau führte den Begriff der Perfektibilität in seinem Werk „Diskurs über die Ungleichheit“ (1755) ein. Unter Perfektibilität verstand Rousseau die einzigartige Fähigkeit des Menschen, sich selbst und seine Umgebung zu verbessern und weiterzuentwickeln. Perfektibilität bezeichnet dabe ein anthropologisches Konzept sowie ein Ideal der Aufklärung, wobei dieser Begriff aus dem Französischen ins Deutsche übertragen und sowohl mit „Vervollkommnungsfähigkeit“ als auch „Vervollkommnung“ wiedergegeben wird.
Diese Eigenschaft unterscheidet den Menschen nach Rousseau neben der Wahlfreiheit grundlegend von anderen Lebewesen. Für Rousseau war die Perfektibilität ein zweischneidiges Schwert, denn einerseits ermöglicht sie dem Menschen, sich an verschiedene Umgebungen anzupassen und neue Fähigkeiten zu erlernen, sie befähigt den Menschen zur Entwicklung von Sprache, Kultur und Gesellschaft und sie ist die Grundlage für den technischen und wissenschaftlichen Fortschritt, andererseits entfernt sie den Menschen von seinem „Naturzustand“ und führt zu Ungleichheit und sozialen Konflikten, was zu einer Entfremdung und einem Verlust der natürlichen Harmonie führen kann, denn sie ermöglicht auch die Entwicklung von Lastern und schädlichen Verhaltensweisen.
Rousseau sah die Perfektibilität als eine Art schlafende Fähigkeit, die erst durch äußere Umstände und Herausforderungen aktiviert wird. In seinem Naturzustand, so Rousseau, lebte der Mensch in einer Art harmonischem Gleichgewicht mit seiner Umwelt. Erst durch die Aktivierung der Perfektibilität begann der Prozess der Zivilisation, der zwar zu großen Errungenschaften führte, aber auch neue Probleme und Ungleichheiten schuf.
Die Perfektibilität steht auch im Zentrum von Rousseaus Gesellschaftskritik. Er argumentierte, dass die fortschreitende Zivilisation und die damit einhergehende Ungleichheit den Menschen von seinem ursprünglichen, glücklicheren Zustand entfremdet haben, obwohl er anerkannte, dass eine Rückkehr zum Naturzustand weder möglich noch wünschenswert sei.
Rousseaus Konzept der Perfektibilität hatte einen bedeutenden Einfluss auf spätere philosophische und politische Theorien, etwa die Ideen über den menschlichen Fortschritt, die Natur der Gesellschaft und die Rolle der Erziehung. In seinem pädagogischen Werk „Emile oder über die Erziehung“ entwickelte Rousseau Bildungskonzepte, die darauf abzielten, die positiven Aspekte der Perfektibilität zu fördern, ohne die negativen Auswirkungen der Zivilisation zu verstärken.
Der von Rousseau geprägte Begriff der „Perfektibilität“ des Menschen führte schließlich die Pädagogik in die Moderne, da das Kind – anders etwa als ein Tierkind – von Geburt an unbestimmt, entwicklungsoffen, „bildsam“ (Fichte) ist, kann und muss es sich „vervollkommnen“, was auch bedeutet, sich für das vermeintlich Natürliche zu entscheiden oder eben dagegen. Auch die beste Pädagogik kann dem Kind und Jugendlichen nur helfen, seine Entscheidungen frei, und das heißt gutkantianisch immer auch vernünftig zu treffen.
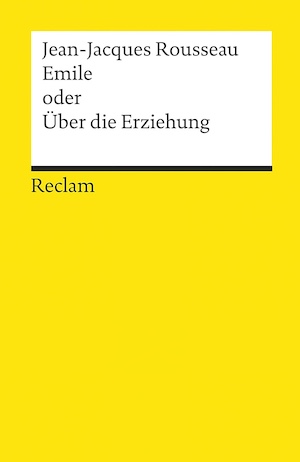 Liest man Jean-Jacques Rousseaus „Émile, oder über die Erziehung“, so ist es geradezu verblüffend, wie ausführlich er auf alltagspraktische Fragen eingeht, z.B. auf das Wickeln: „Duldet nicht, dass man dem Kind nach dem ersten Atemzug eine neue Hülle gibt, die es noch enger fesselt. Keine Mützen, keine Binden, keine Windeln, sondern weite, nicht zu enge Windeln, in denen es alle Glieder frei bewegen kann“.
Liest man Jean-Jacques Rousseaus „Émile, oder über die Erziehung“, so ist es geradezu verblüffend, wie ausführlich er auf alltagspraktische Fragen eingeht, z.B. auf das Wickeln: „Duldet nicht, dass man dem Kind nach dem ersten Atemzug eine neue Hülle gibt, die es noch enger fesselt. Keine Mützen, keine Binden, keine Windeln, sondern weite, nicht zu enge Windeln, in denen es alle Glieder frei bewegen kann“.
Hinsichtlich der Badetemperatur verweist Rousseau auf Naturvölker, die ihre Neugeborenen in Flüssen waschen, was beweise, dass die Erwärmung des Badewassers ein Irrweg der Zivilisation sei. Ob es um die Ernährung von stillenden Müttern oder Ammen geht (Gemüsekost!), um den richtigen Zeitpunkt der Entwöhnung (nicht zu früh!) oder um das Zahnen (Holz, Leder oder Stofffetzen!) – Rousseau weiß Rat. Seine Devise lautet: Der Natur nicht ins Handwerk pfuschen!
Zugegeben, „Émile“ ist kein philosophisches Werk im engeren Sinne, sondern eine Mischung aus Roman und Traktat über die ideale Erziehung. Rousseau wählt ausdrücklich diese virtuelle Form, weil er sich selbst für die anspruchsvolle reale Erziehungsaufgabe nicht geeignet hält. Als „Émile“ 1762 erschien, hatte Rousseau bereits fünf Kinder seiner Lebensgefährtin Marie-Thérèse Levasseur in ein Waisenhaus gegeben.
Die scharfzüngigen Passagen über versagende Väter lassen sich als bitteres Eingeständnis eigener Schuld lesen. Aber auch die Großstadtmütter, die, wie damals üblich, ihre Kinder Ammen auf dem Land anvertrauen, um sich „fröhlich in die Vergnügungen der Stadt“ zu stürzen, bekommen für diesen Verrat an der Natur eine heftige Breitseite ab.
Bei allem Festhalten an vermeintlich „natürlichen“ Geschlechterrollen: Fortschrittlich ist bei Rousseau auch, wie er, orientiert an einem damals revolutionären Begriff des Kindeswohls, Väter und Mütter in die Pflicht nimmt. Dem Erzeuger kommt freilich die Rolle des „natürlichen Erziehers“ zu.
Literatur
Baum, R., Neumeister, S. & Hornig, G. (1989). Perfektibilität. In Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 7, S. 238–244.