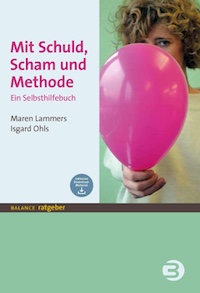 Fremdschämen ist ein Begriff, der beschreibt, wie man sich für das Verhalten oder die peinlichen Handlungen einer anderen Person schämt, d. h., es tritt auf, wenn man mitansehen muss, wie jemand sich unangemessen oder peinlich verhält, und man selbst sich in die Lage dieser Person hineinversetzt. Das Gefühl des Fremdschämens kann sehr unangenehm sein, auch wenn man nicht direkt in die Situation involviert ist.
Fremdschämen ist ein Begriff, der beschreibt, wie man sich für das Verhalten oder die peinlichen Handlungen einer anderen Person schämt, d. h., es tritt auf, wenn man mitansehen muss, wie jemand sich unangemessen oder peinlich verhält, und man selbst sich in die Lage dieser Person hineinversetzt. Das Gefühl des Fremdschämens kann sehr unangenehm sein, auch wenn man nicht direkt in die Situation involviert ist.
Fremdscham beschreibt demnach das unangenehme Gefühl der Scham oder Peinlichkeit, das man empfindet, wenn man das Verhalten oder die Handlungen einer anderen Person beobachtet, die man als unangemessen, peinlich oder sozial unakzeptabel empfindet. Fremdscham ist dabei das Gegenteil von Schadenfreude, bei der positive Gefühle hervorgerufen werden, wenn jemand anders scheitert oder sich blamiert, und die etwa auftritt, wenn sich jemand in einer sozialen Situation ungeschickt verhält oder sich auf eine Weise präsentiert, die man selbst als unpassend oder unangemessen einschätzen würde. Unter Fremdschämen versteht man also das Verhalten eines Menschen, der beim Anblick einer peinlichen Situation, in der eine andere Person ist, betroffen reagiert, als wäre ihr bzw. ihm selber das Missgeschick passiert.
Fremdscham bzw. Fremdschämen zählt zu den sozialen Emotionen, wobei es unter diesen eine Sonderstellung einnimmt, denn man kann sich nicht stellvertretend für andere eifersüchtig fühlen oder für jemand anderen schuldig fühlen. Dabei ist es bei Fremdscham unerheblich, ob der Betroffene sich absichtlich oder unabsichtlich einen Fehler leistet oder ob der Betroffene überhaupt bemerkt, dass sein Verhalten peinlich ist. Menschen mit hohem Einfühlungsvermögen sind dabei anfälliger für Peinlichkeiten der Mitmenschen. Fremdscham tritt daher bei Frauen häufiger auf, was vermutlich an deren ausgeprägteren Fähigkeit zur Empathie liegt und daran, dass sich Frauen generell stärker mit Menschen identifizieren können. Diese Emotionen entwickelt sich bereits sehr früh im Kindesalter, wobei man dafür die Fähigkeit haben muss, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, was sich in der Regel zwischen dem siebten und neunten Lebensjahr entwickelt. Zusätzlich muss kognitiv ein Verständnis dafür entwickelt worden sein, welche sozialen Normen es gibt und wann diese gelten. Daher sind Empathie und Identifikation für das Fremdschämen essenziell, denn fehlen diese, entsteht das verwandte komplementäre Gefühl der Schadenfreude, bei der man man eine Normverletzung ebenfalls wahrnimmt, bei dieser aber die belohnende Komponente im Vordergrund steht. Bei der Schadenfreude geht es weniger um das Mitgefühl als darum, sich selbst über die betroffene Person zu stellen, der gerade etwas Peinliches passiert, wobei die Übergänge manchmal fließend sind, denn je nach Motivation und Stimmung kann die gleiche Situation entweder Schadenfreude oder Fremdscham auslösen oder auch von der einen in die andere soziale Emotion umkippen. Dieses Phänomen stellvertretender Scham ist im übrigen unabhängig davon, ob die betroffene Person selbst die Situation als peinlich wahrnimmt, denn das Gefühl des Fremdschämens tritt auch auf, wenn etwa ein Mann mit offener Hose durch eine Fußgängerzone geht und dies selber gar nicht bemerkt. Nach neuesten Untersuchungen werden beim Beobachten peinlicher Situationen anderer die gleichen Hirnareale aktiviert wie beim Anblick körperlicher Schmerzen eines Mitmenschen. Vermutlich sind auch dafür Spiegelneuronen verantwortlich 😉 (Stangl, 2023).
Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es einen Zusammenhang zwischen Empathie und Fremdschämen gibt, denn Menschen, die sich selbst empathischer einschätzen als andere, leiden auch mehr mit anderen mit. Sie können sich besser in andere hineinversetzen und empfinden dann vermeintlich unangenehme Momente auch als peinlich. Außerdem hängt es von der Situation ab, ob und wie stark Fremdscham empfunden wird. Hinzu kommen die individuellen Norm- und Wertvorstellungen, anhand derer man selbst die Grenzen dessen festlegt, was man als peinlich empfindet. Fremdschämen ist also ein hochkomplexer sozialer Prozess, der immer nur in einem bestimmten Kontext funktioniert. Das heißt auch: An einem Tag schämt man sich für eine Situation, am nächsten Tag könnte sie einem nicht peinlicher sein.
Literatur
Stangl, W. (2014, 16. Oktober). Spiegelneuronen. Online Lexikon für Psychologie & Pädagogik.
https:// lexikon.stangl.eu/932/spiegelneuronen.