Die Ekstase stellt in der psychologischen Forschung ein Phänomen dar, das trotz seiner kulturellen und historischen Bedeutung bisher vergleichsweise wenig Beachtung gefunden hat. Während Begriffe wie Angst im wissenschaftlichen Diskurs Tausende von Publikationen hervorgebracht haben, sind konkrete Untersuchungen zur Ekstase rar, wie eine Suche in der Datenbank PubPsych zeigt (Kirakosian, 2025). Diese Zurückhaltung ist nicht zuletzt auf die lange Zeit vorherrschende Aufklärungsperspektive zurückzuführen, die ekstatische Zustände als irrational und außerhalb des wissenschaftlich Fassbaren betrachtete. Historisch hingegen wurde Ekstase als tiefgehende Verbindung des Menschen mit dem Göttlichen verstanden, wie es in der Antike etwa Philon von Alexandria formulierte: Ekstase bedeutete hier, dass der göttliche Geist das menschliche Verständnis übersteigt und temporär verdrängt. Auch im Mittelalter galt Ekstase als gleichwertiger Weg zur Gotteserkenntnis neben der scholastischen Vernunft.
Diese historische Dimension betont nicht nur die spirituelle Transzendenz der Ekstase, sondern verweist auch auf deren ambivalente Natur. Rauschzustände wurden und werden seit jeher durch externe Faktoren wie Tanz, Musik oder psychoaktive Substanzen gefördert, angefangen beim Dionysoskult bis hin zu den Derwischen oder modernen Massenveranstaltungen. Ein zentrales Element ist dabei das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft, das ekstatische Erlebnisse beglückend macht, jedoch auch eine „dunkle Seite“ besitzt, wenn sie in destruktiven Kontexten wie fanatischen politischen Massenversammlungen instrumentalisiert wird. Interessanterweise kann Ekstase über Schmerz erfahren werden, denn asketische Praktiken und Selbstgeißelungen begleiteten bei mittelalterlichen Mystikerinnen ekstatische Visionen, wobei deren soziale Wahrnehmung zwischen Heiligsprechung und Verfolgung schwankte, ein ambivalentes Spannungsfeld, das bis in die Psychiatrie des 19. Jahrhunderts nachwirkte.
Psychologisch wird Ekstase heute als intensiver veränderter Bewusstseinszustand verstanden, der mit Selbsttranszendenz, Auflösung der Ich-Grenzen und veränderten Wahrnehmungen von Zeit und Raum einhergeht. Sie kann spontan auftreten oder durch Techniken wie Meditation, Rituale, Tanz, Musik oder psychedelische Substanzen induziert werden (Barrett, Griffiths & Johnson, 2017). Ekstase ist nicht nur ein spirituelles Erlebnis, sondern auch Ausdruck tiefster positiver Emotionen wie Freude oder Hingabe. Die neuropsychologische Forschung verbindet ekstatische Zustände mit einer starken Aktivierung des Belohnungssystems im Gehirn, was intensive Euphorie und ein Gefühl der Einheit mit der Umwelt zur Folge hat (Griffiths et al., 2006). Oft wird Ekstase im Zusammenhang mit dem Flow-Erleben untersucht, einem Zustand völligen Aufgehens in einer Tätigkeit, wie ihn Csikszentmihalyi (1990) beschrieben hat. Dennoch unterscheidet sich Ekstase durch ihre überwiegend transzendente, oft auch extreme Qualität deutlich von den alltäglicheren Flow-Zuständen.
Die psychische Wirkung von Ekstase ist ambivalent: In kontrollierten Kontexten kann sie als bereichernd und heilend erlebt werden, andererseits können ekstatische Zustände auch mit Realitätsverlust und psychopathologischen Symptomen einhergehen, etwa bei psychotischen Erkrankungen (Stanghellini, 2004). Diese Komplexität macht deutlich, dass Ekstase als Forschungsgegenstand eine interdisziplinäre Annäherung erfordert, die kulturelle, historische, neuropsychologische und spirituelle Dimensionen einbezieht.
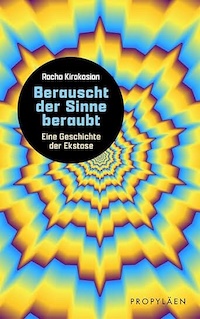 Kirakosian (2025) rückt in ihrem Buch „Berauscht der Sinne beraubt“ vor allem die historische und kulturelle Vielfalt ekstatischer Erfahrungen in den Vordergrund und kritisiert zugleich naturwissenschaftliche Reduktionen, die Ekstase ausschließlich auf biochemische Prozesse zurückführen wollen. Sie zeigt auf, dass ekstatische Zustände in unterschiedlichen Epochen als bedeutsame Formen der Gotteserkenntnis und menschlichen Erfahrung galten, warnt jedoch auch vor einer allzu kritischen Ablehnung ekstatischer Ausdrucksformen, wie sie etwa im 19. Jahrhundert gegenüber Frauen mit ekstatischen Visionen praktiziert wurde. Ihre Darstellungen illustrieren, dass Ekstase ein Phänomen ist, das sowohl Erhebung als auch Ausgrenzung hervorgerufen hat und das bis heute in vielen kulturellen und wissenschaftlichen Kontexten umstritten bleibt.
Kirakosian (2025) rückt in ihrem Buch „Berauscht der Sinne beraubt“ vor allem die historische und kulturelle Vielfalt ekstatischer Erfahrungen in den Vordergrund und kritisiert zugleich naturwissenschaftliche Reduktionen, die Ekstase ausschließlich auf biochemische Prozesse zurückführen wollen. Sie zeigt auf, dass ekstatische Zustände in unterschiedlichen Epochen als bedeutsame Formen der Gotteserkenntnis und menschlichen Erfahrung galten, warnt jedoch auch vor einer allzu kritischen Ablehnung ekstatischer Ausdrucksformen, wie sie etwa im 19. Jahrhundert gegenüber Frauen mit ekstatischen Visionen praktiziert wurde. Ihre Darstellungen illustrieren, dass Ekstase ein Phänomen ist, das sowohl Erhebung als auch Ausgrenzung hervorgerufen hat und das bis heute in vielen kulturellen und wissenschaftlichen Kontexten umstritten bleibt.
Literatur
Barrett, F. S., Griffiths, R. R., & Johnson, M. W. (2017). Neuropsychopharmacology of psychedelics. Psychopharmacology, 234(5), 1093–1109.
Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.
Griffiths, R. R., Richards, W. A., McCann, U., & Jesse, R. (2006). Psilocybin can occasion mystical-type experiences having substantial and sustained personal meaning and spiritual significance. Psychopharmacology, 187(3), 268–283.
Kirakosian, R. (2025). Berauscht der Sinne beraubt. Eine Geschichte der Ekstase. Propyläen.
Stanghellini, G. (2004). Disembodied spirits and deanimated bodies: The psychopathology of common sense. Oxford University Press.