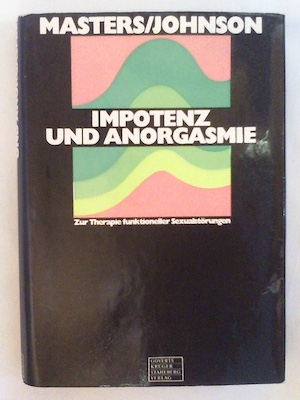 Als Anorgasmie oder Orgasmushemmung wird eine Orgasmusstörung bei Frauen und Männern bezeichnet, die durch ein häufiges oder andauerndes Fehlen eines sexuellen Höhepunktes bei ungestörter Erregungsphase ausgezeichnet ist. Bestehen Schwierigkeiten mit dem Orgasmus spricht man von einer Orgasmusstörung. Darunter fallen beim Mann drei verschiedene Arten, von denen jedoch meist nur eine größere Aufmerksamkeit bekommt: der vorzeitiger Samenerguss. Allerdings gibt es noch zwei weitere Arten. Diese sind zum einen der gehemmte Samenerguss (Ejaculatio retarda) oder auch gehemmter Orgasmus (Delayed Orgasm) und das Unvermögen zum Samenerguss (Ejaculatio deficiens) bzw. die Anorgasmie.
Als Anorgasmie oder Orgasmushemmung wird eine Orgasmusstörung bei Frauen und Männern bezeichnet, die durch ein häufiges oder andauerndes Fehlen eines sexuellen Höhepunktes bei ungestörter Erregungsphase ausgezeichnet ist. Bestehen Schwierigkeiten mit dem Orgasmus spricht man von einer Orgasmusstörung. Darunter fallen beim Mann drei verschiedene Arten, von denen jedoch meist nur eine größere Aufmerksamkeit bekommt: der vorzeitiger Samenerguss. Allerdings gibt es noch zwei weitere Arten. Diese sind zum einen der gehemmte Samenerguss (Ejaculatio retarda) oder auch gehemmter Orgasmus (Delayed Orgasm) und das Unvermögen zum Samenerguss (Ejaculatio deficiens) bzw. die Anorgasmie.
Anorgasmie tritt bei Frauen häufiger auf als bei Männern, wobei nur etwa ein Drittel der sexuell aktiven Frauen von regelmäßigen Orgasmen berichtet und sogar 5 bis 10 % geben an, noch niemals einen Orgasmus erlebt zu haben. Bei Männern muss eine Anorgasmie von einer Ejakulationsstörung im engeren bzw. einer erektilen Dysfunktion im weiteren Sinne abgegrenzt werden. Anorgasmie kann auch durch die Einnahme von Medikamenten oder Drogen ausgelöst werden. Teilweise vermutet man psychischen Faktoren wie Sexualangst als Ursachen für Anorgasmie.
Es ist bekannt, dass bis zu 30% der Frauen unter weiblicher Orgasmusstörung leiden, der zweithäufigsten Form weiblicher sexueller Dysfunktion. Burri, Cherkas & Spector (2009) untersuchten in einer Studie mit Frauen, ob normale Variationen der emotionalen Intelligenz, d.h. der Fähigkeit, die Emotionen von sich selbst und anderen zu erkennen und mit ihnen umzugehen, mit der Häufigkeit von Orgasmen während des Geschlechtsverkehrs und der Masturbation zusammenhängen. Es wurde festgestellt, dass die emotionale Intelligenz positiv mit der Orgasmushäufigkeit während des Geschlechtsverkehrs korreliert, d.h. eine niedrige emotionale Intelligenz scheint ein wichtiger Risikofaktor für eine niedrige Orgasmushäufigkeit zu sein.
Ejakulation und Orgasmus werden häufig synonym füreinander verwendet, jedoch handelt es sich hierbei eigentlich um zwei verschiedene Phänomene, wobei die Ejakulation den Fluss der Samenflüssigkeit sowie die antegrade Ejakulation beschreibt. Der männliche Orgasmus entsteht sekundär zum Druckaufbau in der Urethra durch Kontraktion der periurethralen Muskulatur. Zwar ist eine Ejakulation ohne Orgasmus möglich, kommt jedoch sehr selten vor. Daher werden auch in der Fachliteratur beide Begriffe synonym verwendet.
Pavlicev et al. (2019) glauben nun nach Experimenten mit Kaninchen, dass der weibliche Orgasmus einen Mechanismus verwendet, der ursprünglich dazu gedacht war, den Eisprung während der Paarung zu induzieren, ein Mechanismus, der bei einigen Tieren (Hasen, Katzen, Frettchen oder Kamelen) noch existiert, aber bei den meisten anderen (vor allem Primaten) seine Rolle verloren hat. Das ovulatorische homologe Modell des weiblichen Orgasmus geht demnach davon aus, dass die neuroendokrinen Prozesse, die dem weiblichen Orgasmus zugrunde liegen, homolog zu jenen sind, die den kopulationsbedingten Eisprung bei einigen Säugetieren auslösen. Man verabreichte den Tieren über zwei Wochen den Serotonin-Aufnahmehemmer Fluoxetin, ein Antidepressivum, das beim Menschen die Orgasmusfähigkeit stark vermindert und vergleichbare Reaktionen bei weiblichen Kaninchen unterbinden kann. Am Tag nach der Kopulation zeigten die Tiere tatsächlich um rund dreißig Prozent weniger Eisprünge als die Kontrollgruppe. Dieses Modell zeigt also, dass Wirkstoffe wie Fluoxetin den Eisprung bei Tieren mit kopulationsbedingter Ovulation beeinflussen. In diesem Experiment konnte demnach nachgewiesen werden, dass die Wirkung von Fluoxetin auf die kopulationsbedingten Ovulationsraten ein ovulatorische homologes Modell des weiblichen Orgasmus unterstützen, was darauf hindeutet, dass der weibliche Orgasmus tiefe evolutionäre Wurzeln unter den frühen Säugetieren hat.
Bei über 200 Präriewühlmäusen wurde die Hirnaktivität vor, während und nach dem Orgasmus untersucht, wobei die menschlichen Hirnströme mit denen der monogam lebenden Nager während des Aktes vergleichbar sind. Während bei den Weibchen nicht untersucht werden konnte, ob sie tatsächlich zum Höhepunkt kommen, ist zumindest nach der Ejakulation der Männchen klar, dass die Tiere einen Sturm von Hirnaktivitäten erleben, die sich auf 68 verschiedene Hirnregionen verteilen. Die Hirnaktivität nach dem männlichen Orgasmus ist bei beiden Geschlechtern nahezu identisch, obwohl sich die vorherrschenden Sexualhormone bei Männchen und Weibchen deutlich unterscheiden, d.h. die aktiven Hirnregionen waren bei männlichen und weiblichen Mäusen im Test sehr ähnlich, obwohl nicht überprüft werden konnte, ob beide zum Orgasmus gekommen waren. Mehrere der aktivierten Hirnregionen sind dafür bekannt, Bindungen zu bilden und zu stärken, so dass die Hirn- und Verhaltensdaten darauf hindeuten, dass beide Geschlechter orgasmusähnliche Reaktionen zeigen und dass diese Orgasmen die Bildung von Bindungen koordinieren. Je mehr Orgasmen die Mäuse haben, desto enger sind sie an ihren Partner gebunden, mit dem sie ihren Bau und ihr Territorium verteidigen und ihren Nachwuchs aufziehen. Eine einzige Studie an Nagetieren reicht natürlich nicht aus, um allgemeingültige Aussagen zu treffen (Stangl, 2024).
Literatur
Burri, A. V., Cherkas, L. M. & Spector, T. D. (2009). Emotionale Intelligenz und ihre Verbindung mit der Orgasmusfrequenz bei Frauen. Zeitschrift für Sexualmedizin, 6, 1930–1937.
Pavlicev, Mihaela, Zupan, Andreja Moset, Barry, Amanda, Walters, Savannah, Milano, Kristin M., Kliman, Harvey J. & Wagner, Günter P. (2019). An experimental test of the ovulatory homolog model of female orgasm. Proceedings of the National Academy of Sciences, doi:10.1073/pnas.1910295116.
Stangl, W. (2024). Orgasmus.
WWW: https://sexikon.stangl.eu/orgasmus.shtml (24-03-13).