Menschen, die extreme körperliche Gewalt, einen Terroranschlag, Unfall, Krieg oder sonst Erschütterndes erlebt haben, schaffen es mitunter nicht, das Erlebte zu verarbeiten. Bei der posttraumatischen Belastungsstörung wird für die Betroffenen die Erinnerung zum Problem, denn belanglose Kleinigkeiten wie ein Geruch, ein Gegenstand oder ein Mensch lösen ohne Vorwarnung Flashbacks aus. Typisch ist auch, neben Symptomen wie zwanghaftes Grübeln oder Reizbarkeit, dass Betroffene sich an wesentliche Teile des Geschehens nicht vollständig erinnern können, offenbar ist bei Trauma-Folgestörungen also auch das Gedächtnis beeinträchtigt.
Ein Trauma ist nach Tanja Michael ein Ereignis, das entweder lebensbedrohlich war oder die körperliche Unversehrtheit bedroht hat und in dem gleichzeitig Angst und Hilflosigkeit erlebt wurden. Besonders belastend für die Betroffenen ist es, dass bei der posttraumatischen Belastungsstörung Flashbacks an das Trauma auftreten, also Schreckensbilder, die ohne Vorwarnung ins Bewusstsein schießen, wobei der durchschnittliche davon Betroffene das fürchterliche Ereignis jeden Tag drei Mal wieder erlebt.
Epidemiologische Studien zeigten, dass die posttraumatische Belastungsstörung ein gravierendes Problem darstellt, denn sexuelle Übergriffe, Kampfhandlungen, Naturkatastrophen, Verkehrsunfälle oder kriminelle Straftaten sind keine Seltenheit. Bei fast allen Traumatisierten treten im unmittelbaren Anschluss an das Trauma Symptome wie ungewollte belastende Erinnerungen, Vermeidung traumarelevanter Stimuli, Schlafprobleme oder Schreckhaftigkeit auf. Oft sind diese Symptome vorübergehend, aber bei einem beachtlichen Anteil der Traumatisierten bleiben sie bestehen und es entwickelt sich eine chronische posttraumatische Belastungsstörung. Kampfhandlungen oder sexuelle Übergriffe erzeugen mit 50 bis 60 Prozent Wahrscheinlichkeit sehr hohe Belastungsstörungs-Raten, wohingegen nur 3 bis 11 Prozent der Opfer von schweren Verkehrsunfällen eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Zusätzlich zu den Kernsymptomen der Störung fühlen sich Betroffene von anderen und der Welt um sie herum entfremdet. Wurde das Trauma mit anderen geteilt, und kamen andere dabei ums Leben, kann es zu schmerzlichen Schuldgefühlen bei den Überlebenden kommen. Eine nichtbehandelte posttraumatische Belastungsstörung führt zu höheren Raten von Familien- und Partnerschaftsproblemen, erhöhten Scheidungsraten sowie höheren Raten von Arbeitsproblemen oder Arbeitslosigkeit. Das Suizidrisiko von Menschen mit unbehandelter posttraumatische Belastungsstörung ist bis zu 15-mal höher als bei nichttraumatisierten Personen. Zusätzlich zu den psychosozialen Problemen ist empirisch belegt, dass erlebte Traumata und posttraumatische Belastungsstörungen auch das Immunsystem negativ beeinflussten und zu mehr physischen Erkrankungen sowie einer erhöhten Sterblichkeitsrate führten. Die auf Traumata fokussierte Psychotherapie ist allerdings sehr wirksam, die gemittelte Effektstärke für diese Therapie ist ähnlich hoch wie die einer Antibiotika-Behandlung bei Lungenentzündungen, doch darf diese gute Effektstärke nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Interventionen nicht allen Menschen helfen, denn etwa 30 bis 40 Prozent profitierten nur teilweise. Die Entwicklung und Erforschung wirksamerer Traumatherapien ist daher ein zentrales Anliegen der Forschung.
Definitionen
1. Definition
„Verzögerte oder verlängerte Reaktionen treten nach belastenden, meist bedrohlichen und katastrophalen Ereignissen auf und können Wochen bis Monate bzw. Jahre andauern, wie z.B. nach Gewalttaten, Unfällen, Naturkatastrophen oder Kriegsereignissen. Kernsymptome sind Wiedererinnerung des traumatisierenden Ereignisses und Vermeidung der Erinnerung sowie Erregung, Alpträume, Reizvermeidung, Abspaltung und „Vergessen“ oder auch Schlafstörungen“ (Schädle-Deininger, 2006, S. 371).
2. Definition
„Die Posttraumatische Belastungsstörung entsteht als eine verzögerte oder protrahierte Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder auf eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalen Ausmaßes. […] Die drei zentralen Symptome sind sich aufdrängende Erinnerungen (Intrusionen, Flashbacks), Vermeidungsverhalten und Übererregung. Die Störung entwickelt sich zumeist einige Wochen bis Monate (selten mehr als sechs Monate) nach dem Trauma“ (Hausmann, 2006, S. 56).
3. Definition
„Die Posttraumatische Belastungsstörung ist eine mögliche Folgereaktion eines oder mehrerer traumatischen Ereignisse (z.B. […]), die an der eigenen Person, aber auch an fremden Personen erlebt werden können. In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilfslosigkeit und durch das traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses“ (Flatten, Gast, Hofmann, Liebermann, Reddemann, Siol, Wöller & Petzold, 2004, S. 3).
4. Definition
„Auf eine kurz oder lang anhaltende Situation schwerster Bedrohung und massivsten Ausmaßes kann sich eine posttraumatische Belastungsstörung als verzögerte oder protrahierte Reaktion zeigen. […] Im Gegensatz zur akuten Belastungsreaktion folgt die Störung dem Trauma mit einer Latenz, die Wochen bis Monate dauern kann“ (Frank, 2007, S. 157).
5. Definition
„Unter der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTB) ist eine verzögerte und anhaltende Reaktion auf ein belastendes Ereignis oder eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung mit katastrophenartigem Ausmaß zu verstehen. Hierzu zählen natürliche oder von Menschen hervorgerufene Katastrophen, Kriegs- und Kampfhandlungen, schwere Unfälle oder das Erleben des gewaltsamen Todes anderer. Ebenso gehört die Erfahrung dazu, Opfer von Verbrechen, Vergewaltigung, Folterung oder Terrorismus zu werden“ (Steinhausen, 2006, S. 204).
6. Definition
Menschen mit der Diagnose posttraumatische Belastungsstörung haben in ihrer Vergangenheit traumatische Situationen wie etwa Unfälle, Kriegsszenarien oder Vergewaltigungen erlebt, wobei sich diese in ihrem Kopf auch Wochen, Monate, oder Jahre nach dem auslösenden Ereignis immer wieder von Neuem abspielen.
Einschneidende traumatische Ereignisse wie Unfälle, Katastrophen und Kriegserfahrungen können zu einem Leiden führen, das heute als posttraumatische Belastungsreaktion (engl.: post-traumatic stress disorder, PTSD), bezeichnet wird. Im Krieg wurde diese Störung früher als Kriegs- oder Bombenneurose bezeichnet. Der Begriff PTSD wurde im Jahr 1980 von Robert Bering geprägt, als dieses Stresssyndrom bei vielen amerikanischen Vietnamveteranen deutlich wurde, deren Wiedereingliederung in das zivile Leben sich als problematisch erwies. Aus diesem Krieg kehrten so viele Veteranen mit massiv beeinträchtigenden Erlebnissen zurück, dass sich auch die Politik mit der Thematik auseinandersetzen musste. Die Symptome können unter Umständen erst Monate nach dem erlittenen traumatischen Erlebnis auftreten. Sie äußern sich nach anfänglicher Abgestumpftheit u. a. in nervöser Reizbarkeit, Kontaktstörungen und Depression. Aber auch positive Veränderungen wie ein neuer Arbeitsplatz oder die Geburt eines neuen Familienmitgliedes können die normale Fähigkeit eines Menschen, Krankheiten abzuwehren, beeinträchtigen.
Eine bekannte posttraumatische Belastungsstörung im Zusammenhang mit Kriegen ist die Bezeichnung von Soldaten als Kriegszitterer, die im Ersten Weltkrieg und auch danach an dieser spezifischen Form einer posttraumatischen Belastungsstörung (Kriegstrauma) litten. Unter anderem war der ständige Artilleriebeschuss sehr belastend, wodurch die meisten Betroffenen unkontrolliert zitterten. Verursacht oder ausgelöst wurde das Krankheitsbild durch psychische Überlastung der Soldaten in Situationen, denen sie im Krieg ausgesetzt waren. Ursprünglich glaubte man, diese Störungen wären durch mechanische Ursachen bedingt, etwa durch die Druckwellen explodierender Granaten oder durch laute Explosionsgeräusche. Heute wird dieses Leiden als nichtorganischer Tremor bezeichnet und den Konversionsstörungen zugeordnet oder als Ausdruckskrankheit angesehen. Im Englischen hatte sich die Bezeichnung Bomb Shell Disease oder auch shell shock eingebürgert, da man glaubte, die Druckwellen der Explosionen hätten die Gehirne an die Schädelwände gedrückt und so beschädigt.
Lokführer sind statistisch gesehen zweimal in ihrem Leben mit traumatischen Ereignissen konfrontiert. Der Umgang mit dem Erlebten kann zu tiefen Traumata führen, besonders wenn sie sich hilflos fühlen, etwa bei Unfällen, die trotz Notbremsung nicht vermeidbar sind. Psychologische Nachsorge ist dabei entscheidend, um eine posttraumatische Belastungsstörung zu verhindern. Dazu gehören schnelle Betreuung und soziale Unterstützung. Obwohl eine posttraumatische Belastungsstörung bei nur etwa 8–10 % der Betroffenen auftritt, können die Symptome ohne frühzeitige Behandlung chronisch werden. Wichtige Präventionsmaßnahmen sind Aufklärung und Entlastungsgespräche. Bei richtiger Behandlung kann die Belastung des traumatischen Erlebnisses in das biographische Gedächtnis integriert werden, wodurch das Ereignis nicht mehr automatisch als Flashback wiederkehrt.
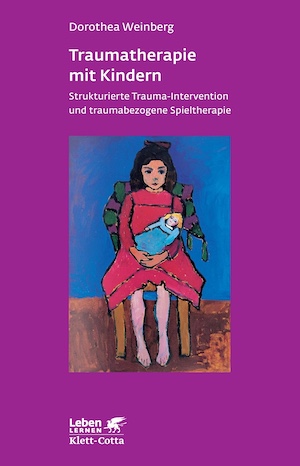 Auch zahlreiche Kinder leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen, etwa nach dem Erleben von Katastrophen, schweren Unfällen oder auch familiären Problemen wie der plötzliche Verlust eines Elternteils durch Tod oder Scheidung können zu dieser Erkrankungen führen. Besonders schwerwiegend sind auch die Folgen von Vernachlässigung, sexuellem Missbrauch und anhaltenden Misshandlungen durch nahe Bezugspersonen. Nach einer Studie von Lewis et al. (2019) könnte einer von 13 jungen Menschen an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Es nahmen mehr als zweitausend Kinder, die 1994-1995 in England und Wales geboren wurden, an der Studie teil und wurden anhand von Interviews bewertet. Die Studie ergab, dass 31 Prozent der Kinder unter 18 Jahren bereits eine traumatische Erfahrung gemacht haben und die Betroffenen doppelt so häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Man fand, dass jedes vierte Kind, das ein traumatisches Erlebnis durchgemacht hatte, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, da es über Symptome wie das Wiedererleben negativer und beängstigender Erfahrungen, Alpträume sowie Isolation und Ablösung berichtet. Zu den weiteren Anzeichen gehören Reizbarkeit, Impulsivität Schuldgefühle und Konzentrationsschwierigkeiten, wobei Betroffene oft alles vermeiden, was sie an das Trauma erinnert. Auch leiden junge Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung häufiger an anderen psychischen Störungen, denn die Hälfte der Befragten hatte sich schon einmal selbst verletzt, jeder Fünfte bereits versucht, sich das Leben zu nehmen, die Hälfte Prozent der Studienteilnehmer gaben an, soziale Isolation oder Einsamkeit erlebt zu haben.
Auch zahlreiche Kinder leiden an posttraumatischen Belastungsstörungen, etwa nach dem Erleben von Katastrophen, schweren Unfällen oder auch familiären Problemen wie der plötzliche Verlust eines Elternteils durch Tod oder Scheidung können zu dieser Erkrankungen führen. Besonders schwerwiegend sind auch die Folgen von Vernachlässigung, sexuellem Missbrauch und anhaltenden Misshandlungen durch nahe Bezugspersonen. Nach einer Studie von Lewis et al. (2019) könnte einer von 13 jungen Menschen an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden. Es nahmen mehr als zweitausend Kinder, die 1994-1995 in England und Wales geboren wurden, an der Studie teil und wurden anhand von Interviews bewertet. Die Studie ergab, dass 31 Prozent der Kinder unter 18 Jahren bereits eine traumatische Erfahrung gemacht haben und die Betroffenen doppelt so häufig mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Man fand, dass jedes vierte Kind, das ein traumatisches Erlebnis durchgemacht hatte, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet, da es über Symptome wie das Wiedererleben negativer und beängstigender Erfahrungen, Alpträume sowie Isolation und Ablösung berichtet. Zu den weiteren Anzeichen gehören Reizbarkeit, Impulsivität Schuldgefühle und Konzentrationsschwierigkeiten, wobei Betroffene oft alles vermeiden, was sie an das Trauma erinnert. Auch leiden junge Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung häufiger an anderen psychischen Störungen, denn die Hälfte der Befragten hatte sich schon einmal selbst verletzt, jeder Fünfte bereits versucht, sich das Leben zu nehmen, die Hälfte Prozent der Studienteilnehmer gaben an, soziale Isolation oder Einsamkeit erlebt zu haben.
Auch bei Amokläufen und ähnlichen Gewalttaten trifft es häufig psychisch auch jene, die bei Gewalttaten zwar körperlich unversehrt blieben, aber Stunden oder Tage bedroht, misshandelt oder missbraucht wurden oder um ihr Leben fürchten mussten. Bei vielen dieser indirekten Opfer findet sich ein posttraumatisches Belastungssyndrom, das erstmals als Krankheitsbild an Vietnam-Veteranen erforscht wurde. Symptome des posttraumatischen Belastungssyndroms sind auf lange Sicht sind Schlafstörungen, Angst, schmerzhafte Erinnerungsschübe, Gefühle von Schuld und Scham, Interessenverlust, Schmerzzustände und Konzentrationsstörungen. Kinder und Jugendliche fallen manchmal in frühere Entwicklungsstufen zurück (Retardierung), indem sie wieder anfangen zu nuckeln oder Bettnässen. Die Psychologie bietet dabei etwa die integrative Zeugnis-Therapie an, bei der es darum, dass die Betroffenen eigenständig und in selbst gewähltem Tempo verdrängte Schmerzen wieder zurück holen und sich die Erinnerungen an das traumatische Erlebnis von der Seele schreiben.
Für viele Betroffene sind aber solche dramatischen Ereignisse mit Tabus und Schweigen belegt, d.h., die Menschen frieren ihre Emotionen ein, was bei unerträglichem seelischen Schmerzen oft kurzfristig einen sinnvollen Überlebensmechanismus darstellt, aber langfristig jedoch die Lebensqualität extrem beeinträchtigen kann. Die Ursache ist meist der Umstand, dass Teile des Erlebten nicht in die übrige Gefühlswelt integriert werden, wobei der Betroffene durch unbewusste Verdrängung Erinnerungslücken entwickelt, aber das Trauma auf einer unbewussten Ebene trotzdem virulent bleibt und Spuren hinterlässt. So genügen ein bestimmtes Lied, ein spezieller Geruch oder der Anblick eines Alltagsgegenstands und schon kehren wie in einem Film die verdrängten Erinnerungsfetzen zurück. Viele traumatisierte Menschen leiden aber nicht nur unter diesen Flashbacks (s. u.), sondern auch unter Schlafstörungen, Albträumen und erhöhter Reizbarkeit, was auch in manchen Fällen Suchtprobleme und sozialen Rückzug zur Folge haben kann. Dadurch wird das alltägliche Leben zu einer schwer bewältigbaren Aufgabe. In der Regel führen grauenhafte Erlebnisse zu einer akuten Stressreaktion, sodass bei den Betroffenen Wochen später beim Gedanken an diese Erlebnisse immer noch vergleichbar starke Reaktionen auftreten, denn unter anderem ist bei dem traumatischen Erlebnis ihr Stresshormonsystem durcheinander geraten, was sie besonders empfindlich macht für Belastungen, auch für einfache Stresssituationen im Alltag. Die genauen neurobiologischen Ursachen der posttraumatischen Belastungsstörung sind noch nicht geklärt, doch bei den Betroffenen ist unter anderem die Amygdala ungewöhnlich aktiv. Gibt es aber eine Situation, die zu Unrecht als Gefahr erkannt wird, werden diese Alarmsignale bei gesunden Menschen schnell wieder abgeschaltet und die Aktivität der Amygdala sinkt. Bei von einer posttraumatischen Belastungsstörung Betroffenen ist jedoch die Aktivität der Amygdala erhöht, wobei gleichzeitig der ventromediale präfrontale Cortex eine deutlich verringerte Aktivität zeigt, also der Bereich in der Hirnrinde, der bei Gesunden die Furchtreaktion kontrolliert. Von einer posttraumatischen Belastungsstörung Betroffene speichern das traumatische Ereignis nicht als normale Erinnerung im Hippocampus ab, also dem Hirnareal, das für die Gedächtnisbildung zuständig ist, sondern es findet eine Art Fehlspeicherung statt, die das unwillkürliche Abrufen der Erinnerungen an das traumatische Erlebnis und damit diese quälenden Flashbacks zur Folge hat. Traumatisierte erleben daher traumatische Ereignisse in ihrer Erinnerung oft wieder und wieder als verstörende und lebhafte Bilder, d. h., als Flashbacks, wobei diese Eindrücke womöglich durch die verstärkte Erinnerung negativer Aspekte entstehen, die nicht an den Kontext gebunden sind, in dem sie stattfanden. Im Zusammenhang mit posttraumatischen Belastungsstörungen vermutet man auch, dass Menschen ohne den richtigen Kontext ihre traumatische Erlebnisse nicht einordnen und verarbeiten können, sodass eine fragmentierte Erinnerung entsteht. Bei „Flashbacks“ tauchen plötzlich Bilder des Geschehens und starke Gefühle wieder auf, die nichts mit der Gegenwart zu tun haben, aber ein Signal für zu leistende Erinnerungsarbeit darstellen können. Erst, wenn das Geschehene wieder ins Bewusstsein integriert wird, fühlen sich die Betroffenen besser. Jedoch sollte kein Betroffener, der von einem solchen traumatischen Erlebnis betroffen war, gezwungen werden, darüber zu reden, sondern es reicht, eine Behandlung anzubieten, d. h., der Wunsch zu einer Therapie muss vom Einzelnen selber kommen, da sonst die Symptome sogar noch verstärkt werden können.
Wiederholte Verwundungen, die durch Menschen absichtlich verursacht werden, lösen ebenfalls häufig eine posttraumatischen Belastungsstörung auf, wobei solche Belastungsstörungen dann zusammen mit weiteren psychischen Störungen auftreten können (Komorbidität). Vor allem wenn Menschen Verwundungen aus früheren Zeiten verdrängt haben, muss ein therapeutischer Rahmen geschaffen werden, um diese Verwundungen bewusst zu machen und einen Heilungsprozess zu ermöglichen, wobei dafür stabile Beziehungen wichtig sind.
Neuere Untersuchungen zeigen nun auch, dass traumatische Ereignisse Schlafstörungen auslösen können, die ihrerseits gedächtnisbezogene Symptome wie Flashbacks, also das ständige Wiedererleben des Traumas, oder Erinnerungslücken verursachen. Siebzig bis über neunzig Prozent der Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen leiden an Ein- und Durchschlafstörungen, wobei der Schlaf generell eine entscheidende Rolle beim Abspeichern ins Langzeitgedächtnis und für das Konsolidieren des Gedächtnisses spielt. Um das Zusammenspiel von Trauma, Schlafstörungen und gedächtnisbezogenen Symptomen der posttraumatischen Belastungsstörung näher zu beleuchten, konfrontierten Sopp et al. (2018) Probanden mit traumatischen Filminhalten. In ihrer experimentellen Studie untersuchten sie, wie sich diese Filminhalte, die eine Art kleines, zeitlich begrenztes Trauma auslösen, bei robusten Schläferinnen und Schläfern ohne Schlafschwierigkeiten auf die Schlafqualität und auf spontane, belastende Erinnerungen auswirken. Die Schlafdauer war in der Trauma-Gruppe reduziert, der Non-Rem-Schlaf signifikant reduziert und die Wachphasen in der Nacht waren länger. Die Probanden der Trauma-Gruppe führten im Anschluss mehrere Tage ein Tagebuch und dokumentierten, wie oft sie an Szenen des Films dachten und wie belastend sie dies empfanden. Außerdem beantworteten sie Fragebögen, in denen typische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung wie Flashbacks abgefragt wurden. Dabei zeigte sich, dass je mehr REM-Schlafphasen die Probanden hatten, desto weniger Flashbacks sie nach Schlüsselreizen hatten und diese auch als weniger belastend empfanden.
Die Bedeutung individueller Denkmuster für die Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung nach traumatischen Ereignissen
Bei einer Untersuchung an Notfallsanitätern (Wild et al., 2016) während ihrer Ausbildung zeigte sich, dass fast alle Teilnehmer während ihrer Ausbildung mindestens eine sehr stark belastende Situation erlebten. Unabhängig von der Anzahl der traumatischen Ereignisse waren besonders Menschen für eine Posttraumatische Belastungsstörung anfällig, die häufig über belastende Situationen grübelten. Insgesamt 8,6 Prozent der Befragten litten im Verlauf ihrer zweijährigen Untersuchung unter dieser psychischen Störung. Für die Vorhersage von Depressionen war der Grad an Selbstvertrauen in die eigene Fähigkeit, mit Belastungen fertig zu werden (Resilienz) besonders bedeutsam, denn eine Depression entwickelten 10,6 Prozent der Untersuchten. Obwohl sich die von psychischen Problemen betroffenen Sanitäter fast alle innerhalb von vier Monaten von ihren Problemen erholten, blieben sie stärker als ihre Kollegen in ihrer Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt, wobei sie auch schlechter schliefen und eine stärkere Gewichtszunahme berichteten. Man schließt daraus, dass es weniger die belastenden Ereignisse an sich sind, die eine psychische Störung vorhersagen, sondern vielmehr die eigenen Denkmuster und der individuelle Umgang mit diesen Erfahrungen.
Computerprogramme gegen die dysfunktionale Informationsverarbeitung nach Traumata
Spezielle Form der Erinnerungen bei einer posttraumatischen Belastungsstörung
Frühere Studien haben gezeigt, dass bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung der Hippocampus ein verringertes Volumen und eine beeinträchtigte Funktion aufweist, eine Hirnregion, die unter anderem beim Abrufen episodischer Erinnerungen aktiv ist. Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass auch der posteriore cinguläre Cortex, der am narrativen Verständnis und der autobiographischen Verarbeitung beteiligt ist, bei der Erkrankung verändert ist. Allerdings fehlen bisher Untersuchungen, die sich auf das individuelle Erleben der Betroffenen konzentrieren, denn bei Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung treten die Erinnerungen an traumatische Erlebnisse häufig als Intrusionen auf, die sich deutlich von der Verarbeitung normaler negativer Erinnerungen unterscheiden. Diese Merkmale haben Theorien genährt, die einen einzigartigen kognitiven Zustand im Zusammenhang mit traumatischen Erinnerungen vermuten, so dass Perl et al. (2023) die neuronale Aktivität von Betroffenen untersuchten, die Erzählungen über ihre eigenen Erinnerungen hörten. Eine Analyse der Ähnlichkeit der Repräsentation zwischen den Probanden in Bezug auf semantische Inhalte und neuronale Muster ergab eine Differenzierung der hippocampalen Repräsentation nach Art der Erzählung: semantisch ähnliche, traurige autobiographische Erinnerungen lösten bei allen Teilnehmern ähnliche neuronale Repräsentationen aus, während semantisch ähnliche traumatische Erinnerungen bei denselben Personen nicht ähnlich repräsentiert wurden. Offenbar verarbeitet das Gehirn traumatische Erinnerungen nicht als normale Erinnerungen oder vielleicht auch gar nicht als Erinnerungen, sondern als Fragmente vergangener Ereignisse, die den gegenwärtigen Moment verdrängen, d.h. diese traumatischen Erinnerungen stellen eine alternative kognitive Einheit dar, die vom eigentlichen Gedächtnis abweicht. Advertisement Ziel einer Psychotherapie sollte es sein, die traumatischen Erinnerungen in einen Gehirnzustand zurückzuführen, der der normalen Gedächtnisverarbeitung ähnelt, d.h. die Betroffenen sollen lernen, das traumatische Ereignis in ihre Lebensgeschichte zu integrieren und die Kontrolle über die Erinnerungen wiederzuerlangen.
Kurze narrative Expositionstherapie
 Persönlichen Reifung nach einem Trauma
Persönlichen Reifung nach einem Trauma
Die Psychotraumatologin Sonja Holzner-Michna beschreibt eine derartige Reifung. Demnach vollzieht das Ethos eine Revision des individuellen oder kulturellen Wertesystems und erlebt eine Steigerung des ethischen oder spirituellen Bewusstseins. Die Entwicklung von Fähigkeiten wie Selbstakzeptanz und Vergebung, Generativität oder sozialem Engagement sowie die Möglichkeit der Ausbildung von Weisheitskompetenzen werden durch diesen Prozess begünstigt. Im Logos erfolgt eine Revision bisheriger Basisannahmen sowie von Überzeugungen, die Autonomie hemmen. Eine fundamentale und realistische OK-Haltung trotz erfahrenen Leides sowie eine Toleranz gegenüber Unsicherheiten nehmen zu. Die Bewältigung des Geschehenen kann Sinn und Bedeutung beigemessen werden, wodurch neue Möglichkeiten im Leben ergriffen werden können. Im Pathos erfolgt eine Bewältigung, bei der kein Rückfall in alte Skriptüberzeugungen oder eine hilflose Opferhaltung zu beobachten ist. Es kommt zu einem Zuwachs an Achtsamkeit, Empathie oder Serenität sowie zu echten, intimen Beziehungen.
Warum Mariahuana möglicherweise hilft
Im Gehirn spielen CB1-Rezeptoren bei der Entstehung der posttraumatischen Belastungsstörung eine wichtige Rolle. Nach neueren Untersuchungen finden sich im Gehirn von Betroffenen deutlich weniger Moleküle des körpereigenen Botenstoffes Anadamid, der an die CB1-Rezeptoren andockt. Insbesondere weibliche PTSD-Patienten haben nicht nur weniger Anadamid in ihrem Gehirn, sondern besitzen auch mehr CB1-Rezeptoren in jenen Regionen, die mit der Verarbeitung von Angst zu tun haben. Dadurch entsteht ein geringer Anadamid-Levels, den das Gehirn durch Herstellung zusätzlicher CB1-Rezeptoren ausgleicht, um die körpereigenen Botenstoffe weiterhin nutzen können. Bisher gibt es keine medikamentöse Behandlung, die eine posttraumatischen Belastungsstörung heilen kann, doch weiß man, dass Trauma-Patienten, die Marihuana konsumieren, eine Milderung der Symptome empfinden, wobei möglicherweise dieses Suchtmittel einen Teil jener Wirkungen übernimmt, die normalerweise dem Anadamid zukommen.
Was kann man für traumatisierte Menschen tun?
- Hören Sie geduldig zu, wenn der oder die Traumatisierte reden will. Aber akzeptieren Sie auch, wenn die betroffene Person dazu noch nicht bereit ist.
- Vertrauen Sie darauf, dass der oder die Betroffene einen Weg findet, das Trauma zu überwinden. Helfen Sie wenn nötig dabei, diesen Weg zu gehen.
- Bestärken Sie die traumatisierte Person darin, sich selber Gutes zu tun: lange Spaziergänge, Massage, Weekend-Urlaub et cetera. Und auch darin, nötigenfalls professionelle Hilfe anzunehmen.
- Akzeptieren Sie Veränderungen: Viele Menschen sind nach einem solch einschneidenden Erlebnis nicht mehr dieselben wie zuvor.
- Bleiben Sie über Wochen oder Monate hinweg aufmerksam und ansprechbar. Viele Reaktionen können erst stark verzögert auftreten – so etwa auch das Bedürfnis zu reden.
- Vermeiden Sie tröstlich gemeinte, aber eigentlich unpassende Phrasen wie «Morgen sieht die Welt wieder anders aus» oder «Es wird alles wieder gut».
- Decken Sie Ihr Gegenüber nicht mit unzähligen Vorschlägen ein, wie man wieder auf die Beine kommen könnte. Er oder sie muss einen eigenen Weg finden.
- Fehl am Platz sind auch ungeduldige Bemerkungen im Stil von: «Jetzt ist es schon vier Wochen her, kannst du nicht endlich vergessen und wieder normal werden?»
- Machen Sie gegenüber der betroffenen Person keine Versprechungen, die Sie nicht einhalten können.
- Nehmen Sie der betroffenen Person nicht wochenlang alles ab, was sie ebenso gut (wieder) selbst bewältigen könnte.
Anmerkung: Studien, in denen man die Symptome von Erkrankungen bei Menschen mit Verhaltensweisen von Tieren verglich, zeigen, dass auch Tiere unter posttraumatische Belastungsstörungen leiden können.
Zeitgeistiges: Es gibt übrigens sogar ein Videospiel namens The Last of Us, dessen Hauptperson Ellie unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Sie kann kaum schlafen und ist getrieben von Rache. Hoffnungslos und verfolgt von ihren Erinnerungen spitzt sich diese Geschichte immer weiter zu, wobei Ellies psychisches Leiden äußerst real wirkt, sodass sich SpielerInnen durchaus mit dieser Hauptfigur identifizieren können. Der Beginn: Vorsichtig schließt man die Tür zu einem heruntergekommenen Theater in Seattle und tritt auf die Straße. Es regnet, es ist kalt und Nebelschwaden ziehen über die grasbedeckten Straßen. Ellie ist allein, doch sie hat eine Mission vor sich, in einem Krankenhaus eine gewisse Nora zu finden. Der Auftrag ist dabei eilig, also Kapuze aufziehen und hinaus in die Straßen. Zwischen tiefen Kratern im Asphalt erstrecken sich blühende Graslandschaften, Schmetterlinge spielen in der Luft, während es sich Krähen auf einem Straßenschild gemütlich gemacht haben. Per Knopfdruck holt man die zusammengefaltete Karte aus der Tasche, immer einem Highway nach, das sollte den Spieler direkt zum Krankenhaus bringen. …
Literatur
Flatten, G., Gast, U., Hofmann, A., Liebermann, P., Reddemann, L., Siol, T., Wöller, W. & Petzold E.R. (2004). Posttraumatische Belastungsstörung. Leitlinie und Quellentext. Stuttgart: Schattauer GmbH Verlag.
Frank, W. (2007). Psychiatrie. München: Urban & Fischer Verlag.
Hausmann, C. (2006). Einführung in die Psychotraumatologie. Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.
Holzner-Michna, Sonja (2024). Posttraumatisches Wachstum – oder: die Geschichte des vergoldeten Gefäßes. In Christoph Seidenfus, Ute Hagehülsmann & Rolf Balling (Hrsg.), Stabilität auf schwankendem Boden – Reifer Umgang mit den Unsicherheiten unserer Zeit. Springer.
Knebel, M., Knaevelsrud, C., Dorr, M., Jarczok, M. N., Vehreschild, J. J., Wensing, M., … & Rau, J. (2025). Effects of a general practitioner-led brief narrative exposure. The BMJ, 389, doi:10.1136/bmj-2024-082092
Lewis, S. J. , Arseneault, L., Caspi, A. et al. (2019). The epidemiology of trauma and post-traumatic stress disorder in a representative cohort of young people in England and Wales. The Lancet Psychiatry, 6, 247-256.
Perl, Ofer, Duek, Or, Kulkarni, Kaustubh R., Gordon, Charles, Krystal, John H., Levy, Ifat, Harpaz-Rotem, Ilan & Schiller, Daniela (2023). Neural patterns differentiate traumatic from sad autobiographical memories in PTSD. Nature Neuroscience, 26, 2226-2236. (
Schädle-Deininger, W. (2006). Fachpflege Psychiatrie. München: Urban & Fischer Verlag.
Michael, T., Sopp, R. & Maercker, A. (2017). Posttraumatische Belastungsstörungen. In J. Margraf & S. Schneider (Eds.), Lehrbuch der Verhaltenstherapie.
M. Roxanne Sopp, Alexandra H. Brueckner, Sarah K. Schäfer, Johanna Lass-Hennemann & Tanja Michael (2018). REM theta activity predicts re-experiencing symptoms after exposure to a traumatic film. Sleep Medicine, 54, 142-152.
Stangl, W. (2022, 10. Juni). Veränderung der dysfunktionale Informationsverarbeitung bei Traumata durch Computertrainings. Psychologie-News.
https:// psychologie-news.stangl.eu/4222/veraenderung-der-dysfunktionale-informationsverarbeitung-bei-traumata-durch-computertrainings
Stangl, W. (2023, 6. Dezember). Spezielle Form der Erinnerungen bei einer posttraumatischen Belastungsstörung. arbeitsblätter news.
https:// arbeitsblaetter-news.stangl-taller.at/spezielle-form-der-erinnerungen-bei-einer-posttraumatischen-belastungsstoerung/
Stangl, W. (2025, 30. Mai). Kurze Expositionstherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung wirksam. arbeitsblätter news.
Kurze Expositionstherapie bei Posttraumatischer Belastungsstörung wirksam
Steinhausen, H.-C. (2006). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. München: Urban & Fischer Verlag.
Wild, J., Smith, K., Thompson, E., Bear, F., Lommen, M. & Ehlers, A. (2016). A prospective study of pre-trauma risk factors for posttraumatic stress disorder and depression. Psychological Medicine, doi:10.1017/S0033291716000532.
http://www.beobachter.ch/leben-gesundheit/psychologie/artikel/trauma_ein_schock_der_das_leben_veraendert/ (12-07-06)
http://science.orf.at/stories/1717734/ (13-05-15)
https://www.dasgehirn.info (15-06-21)
https://idw-online.de/de/news673172 (17-04-20)