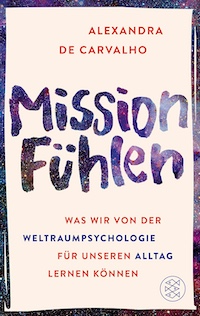 Die Weltraumpsychologie ist ein junges Teilgebiet der Psychologie, das sich mit den mentalen Prozessen, Emotionen und Verhaltensweisen von Menschen in der Raumfahrt beschäftigt. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Menschen unter extremen Bedingungen – etwa Isolation, räumlicher Enge, Ressourcenknappheit, fehlender Privatsphäre und naturferner Umgebung – psychisch stabil und leistungsfähig bleiben können. Astronautinnen und Astronauten müssen über lange Zeiträume in beengten Habitaten leben, mit Schlafmangel, sensorischer Deprivation und eingeschränkten sozialen Kontakten zurechtkommen. Ziel der Weltraumpsychologie ist es, Faktoren zu identifizieren, die das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit fördern, sowie Trainings- und Unterstützungsmethoden zu entwickeln, die das Funktionieren von Teams unter diesen Bedingungen sichern (Kanas & Manzey, 2008). Zentrale Forschungsgebiete sind dabei Stressbewältigung, Konfliktmanagement, Motivation, Gruppendynamik und kognitive Leistungsfähigkeit in Extremsituationen. Die Arbeit der Weltraumpsychologie umfasst dabei sowohl die Auswahl geeigneter Persönlichkeiten für Missionen als auch deren psychologische Vorbereitung und Betreuung während und nach dem Flug. Eigenschaften wie Frustrationstoleranz, Zielstrebigkeit, emotionale Stabilität, Empathie, Vertrauen und Kreativität gelten als entscheidend. Humor, so zeigen etwa Untersuchungen der NASA in Antarktisprojekten, kann als Ressource dienen, um Spannungen abzubauen, birgt aber auch Konfliktpotenzial, wenn er missverstanden wird (Suedfeld, 2012).
Die Weltraumpsychologie ist ein junges Teilgebiet der Psychologie, das sich mit den mentalen Prozessen, Emotionen und Verhaltensweisen von Menschen in der Raumfahrt beschäftigt. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie Menschen unter extremen Bedingungen – etwa Isolation, räumlicher Enge, Ressourcenknappheit, fehlender Privatsphäre und naturferner Umgebung – psychisch stabil und leistungsfähig bleiben können. Astronautinnen und Astronauten müssen über lange Zeiträume in beengten Habitaten leben, mit Schlafmangel, sensorischer Deprivation und eingeschränkten sozialen Kontakten zurechtkommen. Ziel der Weltraumpsychologie ist es, Faktoren zu identifizieren, die das Wohlbefinden und die psychische Gesundheit fördern, sowie Trainings- und Unterstützungsmethoden zu entwickeln, die das Funktionieren von Teams unter diesen Bedingungen sichern (Kanas & Manzey, 2008). Zentrale Forschungsgebiete sind dabei Stressbewältigung, Konfliktmanagement, Motivation, Gruppendynamik und kognitive Leistungsfähigkeit in Extremsituationen. Die Arbeit der Weltraumpsychologie umfasst dabei sowohl die Auswahl geeigneter Persönlichkeiten für Missionen als auch deren psychologische Vorbereitung und Betreuung während und nach dem Flug. Eigenschaften wie Frustrationstoleranz, Zielstrebigkeit, emotionale Stabilität, Empathie, Vertrauen und Kreativität gelten als entscheidend. Humor, so zeigen etwa Untersuchungen der NASA in Antarktisprojekten, kann als Ressource dienen, um Spannungen abzubauen, birgt aber auch Konfliktpotenzial, wenn er missverstanden wird (Suedfeld, 2012).
Da echte Langzeitmissionen im All bislang selten sind, arbeiten Forscherinnen und Forscher mit sogenannten Analogmissionen auf der Erde, bei denen „Analogastronauten“ das Leben und Arbeiten in einer Marsstation oder auf der Mondoberfläche simulieren, etwa in der israelischen Wüste oder der Arktis. Die Psychologin Alexandra de Carvalho betreut solche Teams aus Wien im Rahmen des Österreichischen Weltraum Forums. Sie betont, dass der komplexeste Faktor der astronautischen Raumfahrt die menschliche Psyche sei. Konflikte innerhalb kleiner Gruppen auf engem Raum ließen sich nicht vermeiden, daher wird in diesen Simulationen gezielt Konfliktlösung und Kommunikation trainiert. De Carvalho verweist darauf, dass nicht der Mangel, sondern die Frage „Was brauchen Menschen, um sich wohlzufühlen?“ im Zentrum ihrer Arbeit steht (de Carvalho, 2023).
Die Erkenntnisse der Weltraumpsychologie haben auch Relevanz für das Leben auf der Erde, denn die Reaktionen von Astronauten auf Isolation, Enge und soziale Spannungen bieten wertvolle Einblicke in psychische Anpassungsprozesse, die sich auf viele Bereiche übertragen lassen – etwa auf Menschen, die in Pflegeheimen, auf Bohrinseln, in Krankenhäusern oder während der Corona-Pandemie mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert waren. De Carvalho selbst beschreibt diese Zeit als „globale Raumfahrtsimulation“: Isolation, Stress in urbanen Umgebungen und fehlende Sinneseindrücke spiegeln die psychische Belastung im All wider. Auch die Analogastronautin Anika Mehlis betont, dass Menschen – ob auf der Erde oder im Weltraum – grundlegende psychische Bedürfnisse teilen: Verlässliche Beziehungen, Nähe, Schutz und Geborgenheit. Isolation könne im All genauso auftreten wie in einem Hochhaus in Berlin. Die Weltraumpsychologie lehrt daher, wie wichtig soziale Bindungen und Psychohygiene sind – etwa durch Rituale, Gespräche und mentale Selbstfürsorge -, und fordert dazu auf, bewusster wahrzunehmen, welche Umweltbedingungen und sozialen Kontakte das individuelle Wohlbefinden fördern. Damit geht die Weltraumpsychologie über ihren ursprünglichen Anwendungsbereich hinaus, denn sie zeigt, dass der Mensch – egal ob auf der Erde oder auf dem Mars – ein soziales Wesen bleibt, das Stabilität in Verbindung, Sinn und Gemeinschaft findet. Die Strategien, die für die mentale Gesundheit im Weltraum entwickelt werden, können daher helfen, mit Isolation, Stress und Entfremdung auch im Alltag besser umzugehen.
Literatur
de Carvalho, A. (2023). Vortrag beim Silbersalz-Festival, Halle (Saale), Deutschland.
Kanas, N., & Manzey, D. (2008). Space Psychology and Psychiatry (2nd ed.). Springer.
Suedfeld, P. (2012). Psychological studies in space: The challenge of extreme environments. Annual Review of Psychology, 63, 1–22.