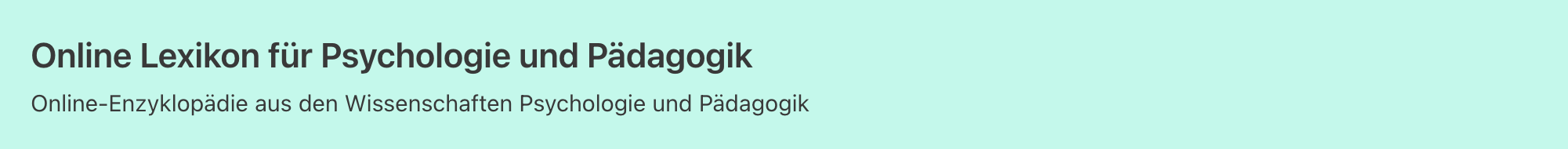
Paraphilien sind von der gesellschaftlichen Norm abweichende sexuelle Vorlieben, die sich zunächst meist in der Phantasie abspielen und unter der Voraussetzung der Einvernehmlichkeit auch gelebt werden können. Paraphilien umfassen unter anderem auch eine Gruppe psychischer Störungen, die sich als ausgeprägte und wiederkehrende, von der empirischen Norm abweichende, sexuell erregende Phantasien, dranghafte sexuelle Bedürfnisse oder Verhaltensweisen äußern, und sich meist auf unbelebte Objekte beziehen. Der Exhibitionismus nimmt unter den Paraphilien eine Sonderstellung ein, denn beim genitalen Präsentieren gegenüber Fremden fehlt in der Regel die Einvernehmlichkeit und ist somit eine strafbare Handlung.
Autonepiophilie (Diaperism): Erregung durch das Tragen von Windeln
Choreophilie: die Neigung, sich durch Tanzen sexuell stimulieren zu lassen
Dämonophilie: sexuelle Bevorzugung von Geistern
Doraphilie: besondere Erregung durch das Berühren von Fellen
Erotophonie: Erregung und Befriedigung durch Telefonsex mit Unbekannten
Exkrementophilie: sexuelle Bevorzugung von Ausscheidungen
Hierophilie: sexuelle Erregung durch religiöse Objekte
Kleptophilie: sexuelles Lustempfinden durch Stehlen
Kynophilie: erotische Hinziehung eines Menschen zu Hunden
Mysophilie: sexuelle Erregung durch das Empfinden unangenehmer Gerüche oder Geschmäcker
Narratophilie: Fixierung auf beziehungsweise ausschließliche Erregung durch Gespräche mit sexuellem Inhalt
Objektophilie: die erotische Liebe zu einem Objekt, z.B. Hochhaus oder Fähre
Pictophilie: sexuelle Lust an Gemälden
Plushophilie: sexuelle Erregung durch Stoff- oder Plüschtiere, darunter die Arktophilie (Liebe zu Teddybären)
Salirophilie: die Lust, den Partner mit breiigen, schleimigen oder schlammigen Substanzen zu besudeln
Stichophilie: Liebe oder Leidenschaft für Verse, Zeilen oder Poesie
Urophilie: sexuelle Erregung durch Urin
Vampirismus: sexuelle Erregung durch Beißen und Blutsagen
Xenophilie: zwanghafte Suche nach sexuellen Erlebnissen mit Fremden
Zoophilie: sexuelle Erregung durch die Nähe von Tieren
Paraphilien bezeichnen sexuelle Neigungen, die von gesellschaftlich anerkannten Normen abweichen. Während „Love is love“ in Bezug auf Homosexualität mittlerweile ein weit verbreiteter Slogan geworden ist, bleibt der Umgang mit anderen Formen der Sexualität schwierig. Denn hier verlaufen die Grenzen zwischen privater Vorliebe und strafbarer Handlung oft fließend. Neigungen wie Fetischismus, BDSM oder Rollenspiele sind gesellschaftlich zunehmend akzeptiert, andere wie Pädophilie, Sadismus oder Sodomie dagegen stoßen auf scharfe Ablehnung, da sie unmittelbar mit Fragen nach Leid, Gewalt oder fehlendem Konsens verknüpft sind.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass Paraphilien keineswegs ein modernes Phänomen sind. Schon in der Antike und im Adel vergangener Epochen finden sich Hinweise auf Praktiken, die heute als pathologisch oder kriminell eingestuft würden. Doch was als „abweichend“ gilt, ist nicht nur eine Frage der Biologie, sondern vor allem des gesellschaftlichen und kulturellen Kontexts. Homosexualität war in Deutschland bis 1994 strafbar, während sie heute in vielen Regionen selbstverständlich gelebt wird. Weltweit zeigt sich jedoch eine enorme Spannbreite: In manchen Ländern gilt sie noch immer als Verbrechen, in extremen Fällen sogar mit Todesstrafe. Dieses Beispiel macht deutlich, wie stark Sexualität von zeitlich und kulturell wandelbaren Normvorstellungen geprägt ist.
Auch die medizinisch-diagnostische Sicht auf Paraphilien ist nicht einheitlich. Im ICD-10 wurden alle sexuellen Normabweichungen pauschal als Störung betrachtet, unabhängig davon, ob Betroffene oder Dritte darunter leiden. Das ICD-11 nimmt zwar eine Neuordnung vor, bleibt aber weiterhin auf die reine Abweichung vom „Normalen“ fokussiert. Deutlich differenzierter geht das DSM-5 vor, indem es klar zwischen „Paraphilien“ und „paraphilen Störungen“ unterscheidet. Eine Paraphilie ist demnach zunächst nur eine ungewöhnliche sexuelle Vorliebe. Erst wenn daraus Leiden entsteht oder andere Menschen zu Schaden kommen, liegt eine Störung mit Krankheitswert vor. Diese Sichtweise entspricht eher dem modernen Verständnis von Toleranz und Konsens, da sie nicht automatisch Abweichung mit Pathologie gleichsetzt.
Die Frage nach der Heilbarkeit von Paraphilien zeigt die Grenzen der Therapie auf. Weder psychotherapeutische Verfahren noch medikamentöse Ansätze können die Neigungen vollständig „auslöschen“. Verhaltenstherapie, soziales Kompetenztraining oder medikamentöse Eingriffe mit Antiandrogenen und Hormonen zielen nicht auf die Beseitigung, sondern auf die Kontrolle von Impulsen und Fantasien. Medikamente können den Sexualtrieb mindern, Psychotherapie kann Strategien vermitteln, mit Triggern umzugehen. Doch die eigentlichen Vorstellungen verschwinden nicht, sie lassen sich höchstens in den Hintergrund drängen. Die wissenschaftliche Forschung hat bisher keinen Beleg dafür gefunden, dass Paraphilien gänzlich eliminierbar wären.
Eine zusätzliche Herausforderung besteht darin, dass Paraphilien oft mit anderen psychischen Erkrankungen einhergehen. Persönlichkeitsstörungen, Impulskontrollstörungen, Sucht- und Angsterkrankungen treten mit hoher Häufigkeit gemeinsam auf. Besonders Persönlichkeitsstörungen stellen dabei einen Risikofaktor dar, weil sie die Schwelle zur Sexualdelinquenz senken können. Während nicht jeder Mensch mit einer Paraphilie kriminell wird, ist unter Sexualstraftätern die Häufigkeit paraphiler Neigungen deutlich erhöht. Vor allem Pädophilie und sexueller Sadismus stehen in enger Verbindung mit Delinquenz. Welche Art von Persönlichkeitsstörung vorliegt, kann zudem Rückschlüsse auf die Art der Straftat zulassen – etwa ein impulsives Muster bei Vergewaltigern oder ängstlich-unsichere Züge bei Kindesmissbrauchstätern.
Die Behandlung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass viele Betroffene keinen Leidensdruck verspüren oder aus Angst vor Stigmatisierung keine Hilfe suchen. Therapien finden oft erst dann statt, wenn bereits eine Straftat begangen wurde und gerichtliche Auflagen greifen. Damit ist die Prävention stark eingeschränkt, obwohl gerade sie wichtig wäre, um Risiken für Betroffene und Gesellschaft zu minimieren.
Ein weiterer Aspekt ist der gesellschaftliche Wandel im Umgang mit Sexualität. Während Mord in allen Kulturen als unrecht gilt, sind die Grenzen sexueller Moral und Strafbarkeit ständig in Bewegung. Was früher als Kavaliersdelikt galt – etwa das Hinterherpfeifen auf der Straße – wird heute als Belästigung eingeordnet. Vergewaltigung in der Ehe war vor wenigen Jahrzehnten noch legal, heute ist sie ein klarer Straftatbestand. Diese Dynamik verlangt von Therapeuten und Fachleuten besondere Flexibilität und Sensibilität: Diagnosen und Behandlungsmethoden müssen nicht nur psychologisch fundiert, sondern auch zeitgemäß und gesellschaftlich reflektiert sein.
Paraphilien sind also ein vielschichtiges Phänomen, das weder ausschließlich als Krankheit noch allein als Ausdruck sexueller Vielfalt verstanden werden kann. Sie bewegen sich in einem Spannungsfeld aus individueller Freiheit, gesellschaftlicher Norm und rechtlicher Begrenzung. Für den therapeutischen Umgang gilt, dass eine vollständige Heilung nicht möglich ist – entscheidend ist vielmehr die Fähigkeit, Risiken zu minimieren und Betroffene in einen kontrollierten, verantwortungsvollen Umgang mit ihren Neigungen zu führen. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Grenzen von „normal“ und „abweichend“ nie starr sind, sondern sich im Lauf der Zeit immer wieder neu verschieben. Genau darin liegt die Herausforderung, aber auch die Chance: Sexualität in all ihrer Vielfalt zu verstehen, ohne dabei die Sicherheit und Würde anderer zu gefährden.
Literatur
http://www.sueddeutsche.de/ (09-12-12)
http://de.wikipedia.org/wiki/Paraphilie (09-08-09)
https://www.doccheck.com/de/detail/articles/51807-paraphilie-sex-stigma-stoerung (25-09-14)