Wenn wir sicher zu Hause sitzen, wünschen wir uns, wir hätten ein Abenteuer zu bestehen.
Thornton Wilder
Risikobereitschaft ist in der Psychologie die Bereitschaft eines Menschen, bei einer Entscheidung ein Risiko in Kauf zu nehmen bzw. einzugehen, wobei Risikobereitschaft aber von der subjektiven Einschätzung und Bewertung des Risikos in einer Situation abhängig ist. Generell gilt etwa, dass im Durchschnitt Männer mehr Risiken als Frauen eingehen, oder dass bei Menschen mit zunehmendem Alter die Risikobereitschaft eher abnimmt.
Die individuelle Risikoneigung ist daher nicht, wie etwa in der Ökonomie manchmal unterstellt wird, ein über die Lebensspanne hin konstantes Merkmal, sondern Menschen neigen in den meisten Kulturen mit zunehmenden Alter dazu, weniger Risiken einzugehen. Allerdings hängt diese Anpassungsleistung auch von den spezifischen Lebensbedingungen und existentiellen Erfordernissen ab.
Esteky, Wineman & Wooten (2018) haben in einem Experiment nachgewiesen, dass Hedgefondsmanager, die in höheren Stockwerken arbeiten, bei ihren Entscheidungen risikobereiter sind als solche, die in unteren Stockwerken arbeiten. Das trifft auch auf Menschen ganz allgemein zu, denn Probanden in einem Glasaufzug eines 72-stöckigen Gebäudes sollten Wetten abschließen, wobei jene, die mit dem Aufzug auf dem Weg in den 72. Stock waren, risikobereiter waren als jene Studienteilnehmer, die sich mit dem Fahrstuhl in Richtung des Erdgeschoßes bewegten. Offenbar verleiht das höhere Stockwerk ein Gefühl der Macht, das risikoreichere Entscheidungen begünstigt.
2019 haben Lejarraga et al. in einer Untersuchung festgestellt, dass die Geburtsreihenfolge keinen Einfluss auf die Risikobereitschaft im Erwachsenenalter hat. Das widerlegt das familiendynamische Modell des US-Psychologen Frank Sulloway, der davon ausging, dass Erstgeborene von Natur aus stärker und intellektuell besser entwickelt sind, auch da sie die volle Aufmerksamkeit der Eltern erfahren haben. Sie entwickeln seiner Theorie nach eher ein Verhalten, das darauf ausgelegt ist, diesen Status zu erhalten, und müssten alles dafür tun, um die Aufmerksamkeit der Eltern zu erhaschen, wodurch sie eine größere Neigung zum Risiko entwickeln. In einer umfangreiche Untersuchung wurden Daten aus drei verschiedenen Ansätzen kombiniert: Selbsteinschätzungen, Verhaltensmesswerte sowie riskante Lebensentscheidungen. Weder in den Selbsteinschätzungen noch in den Messungen zur Risikobereitschaft fanden die Forscher einen Effekt der Geburtsreihenfolge darauf, wie risikofreudig die Teilnehmer als Erwachsene sind. Auch bei den Entdeckern und Revolutionären fand sich kein Einfluss des Geburtsranges. Kleine Unterschiede gibt es hingegen bei der Intelligenz, denn Erstgeborene schneiden sowohl in IQ-Tests als auch bei der Selbsteinschätzung etwas besser ab als die jüngeren Geschwister, wobei sich dieser Effekt nur in sehr großen Stichproben finden lässt, wobei die Effekte meist so klein sind, dass es zweifelhaft sei, ob sie für den Lebensweg überhaupt bedeutsam sind.
Siehe dazu auch Risikoforschung und Risikoverhalten.
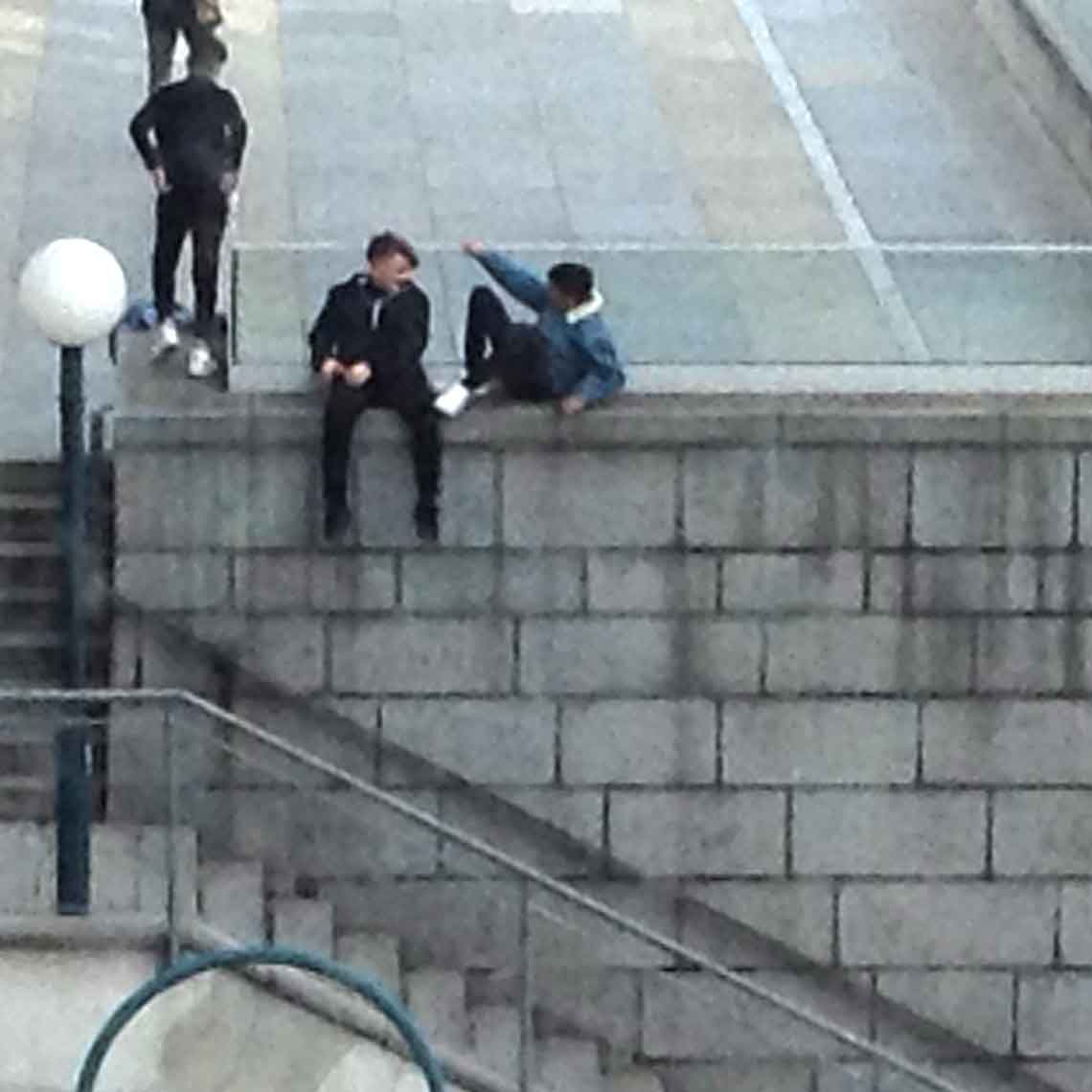
Laube et al. (2017) haben sich mit impulsivem und risikoreichem Entscheidungsverhalten bei Jugendlichen beschäftigt und untersucht, welchen Einfluss Testosteron auf jugendliche Entscheidungen hat. Dabei wurde die Rolle von Hormonen bei impulsiven Entscheidungen untersucht, wobei männliche Jugendliche impulsiver sind als Mädchen, sodass man sich in der Studie auf die Untersuchung von männlichen Jugendlichen im Alter zwischen 11 und 14 Jahren konzentrierte. Zur Feststellung ihres Pubertätsstatus gaben die Probanden zwei morgendliche Speichelproben zur Bestimmung ihres Testosteronspiegels ab, und um etwas über ihr impulsives Verhalten zu erfahren, absolvierten sie einen Entscheidungstest über einen hypothetischen Geldbetrag treffen, der unterschiedlich zeitnah angeboten wurde, wobei sie zwischen einem zeitnahen, kleineren Geldbetrag oder einem höheren Geldbetrag in der Zukunft wählen konnten. Dabei war die Mehrheit der Heranwachsenden für unmittelbare Belohnungen empfänglicher, denn etwa zwei Drittel entschieden sich für den zeitnahen geringeren Geldbetrag. Erst mit zunehmendem Alter fällt der Zeitpunkt der Belohnung weniger ins Gewicht. Erhöhte Impulsivität von Jugendlichen kann daher auf ein Ungleichgewicht in der Reifung des subcortikalen affektiven Netzwerkes und des cortikalen kognitiven Kontrollnetzwerks im Gehirn sowie ihrer Verbindungen zurückzuführt werden, wobei das affektive Netzwerk, das an der Wahrnehmung und Bewertung von Belohnungen beteiligt ist, schneller als das Kontrollnetzwerk und seine Verbindungen reift. Erst mit zunehmendem Alter wird die Verbindung zum Kontrollnetzwerk stärker und Jugendliche lernen, sich zu gedulden und zukünftige Belohnungen wertzuschätzen. Als praktische Konsequenz aus erzieherischer Perspektive ist es vor dem Hintergrund dieser Studienergebnisse ratsam, positives Verhalten von Jugendlichen kurzfristiger zu belohnen, statt auf Belohnungen in der Zukunft zu verweisen.
Genetische und neurobiologische Grundlagen der Risikobereitschaft
In einer kombinierten Stichprobe von über einer Million Individuen haben Karlsson Linnér et al. (2019) genomweite Assoziationsstudien zu allgemeiner Risikotoleranz, Abenteuerlust und riskantem Verhalten in den Bereichen Autofahren, Trinken, Rauchen und Sexualität durchgeführt. Dabei identifizierte man über einhundert bisher unbekannte Genvarianten in neunundneunzig Bereichen des menschlichen Genoms, die mit der Risikobereitschaft eines Menschen und seinem Risikoverhalten verbunden sind. Um die ausschlaggebenden genetischen Varianten zu bestimmen, berücksichtigte man einerseits die selbst-berichtete grundsätzliche Risikobereitschaft und andererseits deren tatsächliches Risikoverhalten etwa beim Rauchen, Trinken, zu schnellem Autofahren oder wechselnden Sexualpartnern. Damit konnte man die genetische Architektur der Risikobereitschaft bestimmen und ermitteln, an welchen Stellen sich die Neigung zu riskantem Verhalten im menschlichen Genom befindet. Allerdings kann man natürlich nicht auf Basis der konkreten DNA eines Menschenn sagen, welches Risiko er oder sie in einer bestimmten Situation eingehen wird, denn während der Zusammenhang zwischen Genvarianten und einem konkretem Merkmal etwa bei der Augenfarbe sehr direkt ist, wird er im Falle der Risikobereitschaft auch von Umweltfaktoren beeinflusst.
Aydogan et al. (2021) haben genetische Informationen mit Gehirnscans von über 25000 Menschen untersucht und gezeigt, dass die genetische Disposition für Risikofreude in mehreren Arealen des Gehirns abgebildet ist. Man hat dabei untersucht, welche genetischen Ausprägungen mit Risikoverhalten korrelieren und auf dieser Basis in einer anderen Stichprobe Voraussagen zur Risikobereitschaft gemacht. Dabei fand man sowohl funktionale als auch anatomische Unterschiede, denn spezifische Ausprägungen zeigten sich dabei in mehreren Gehirnarealen: im Hypothalamus, wo über die Ausschüttung von Hormonen wie Orexin, Oxytocin oder Dopamin die vegetativen Funktionen des Körpers gesteuert werden, im Hippocampus, der für das Abspeichern von Erinnerungen wesentlich ist, im dorsolateralen präfrontalen Cortex, der ein wichtige Rolle bei Selbstkontrolle und kognitivem Abwägen spielt, in der Amygdala, die unter anderem die emotionale Reaktion auf Gefahren steuert, sowie im ventralen Striatum, das bei der Verarbeitung von Belohnungen aktiv wird.
Zusätzlich entdeckte man messbare anatomische Unterschieden im Kleinhirn, das in Studien zu Risikoverhalten normalerweise nicht mit einbezogen wird, da man bisher annahm, dass es hauptsächlich in feinmotorische Funktionen involviert ist. Es scheint jedoch, als würde das Kleinhirn in Entscheidungsprozessen wie dem Risikoverhalten dennoch eine wichtige Rolle spielen, denn im Gehirn von risikobereiteren Menschen fand man weniger graue Substanz in diesen Arealen, auch wenn unklar bleibt, wie diese geringere graue Substanz das Verhalten beeinflusst.
Man vermutet nun aufgrund dieser Ergebnisse, dass es für Risikobereitschaft sowohl eine genetische Prädisposition als auch Unterschiede in Anatomie und Funktion von Gehirnarealen gibt, und zwar nicht alleinstehend, sondern in Kombination. Offen bleibt derzeit noch, inwiefern die Zusammenhänge zwischen genetischer Disposition, neurobiologischen Ausprägungen und Risikoverhalten kausal sind, denn wie genau das Zusammenspiel von Umwelt und Genen das Risikoverhalten beeinflusst Bedarf weiterer Forschung.
Literatur
Aydogan, G., Daviet, R., Karlsson, Linnér R., Hare, T. A., Kable, J. W., Kranzler, H. R., Wetherill, R. R., Ruff, C. C., Koellinger, P. D, Nave, G. (2021). Genetic underpinnings of risky behaviour relate to altered neuroanatomy. Nature Human Behaviour, doi: 10.1038/s41562-020-01027-y.
Esteky, S., Wineman, J. D. & Wooten, D. B. (2018). The Influence of Physical Elevation in Buildings on Risk Preferences: Evidence from a Pilot and Four Field Studies. Journal of Consumer Psychology, doi:10.1002/jcpy.1024.
Karlsson Linnér, Richard, Biroli, Pietro et al. (2019). Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky behaviors in over one million individuals identify hundreds of loci and shared genetic influences. Nature Genetics, 51, 245-257.
Laube, C., Suleiman, A., Johnson, M., Dahl, R. E., & van den Bos, W. (2017). Dissociable effects of age and testosterone on adolescent impatience. Psychoneuroendocrinology, 80, 162-169. doi:10.1016/j.psyneuen.2017.03.012.
Lejarraga, T., Frey, R., Schnitzlein, D. D. & Hertwig, R. (2019). No Effect of Birth Order on Adult Risk Taking.In: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.